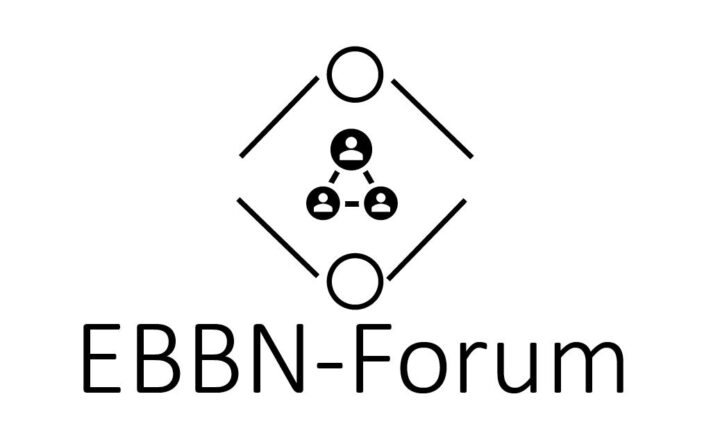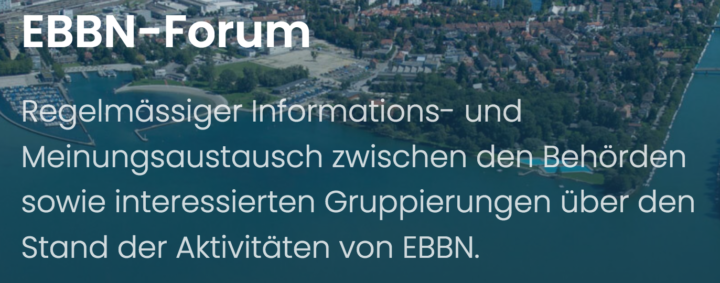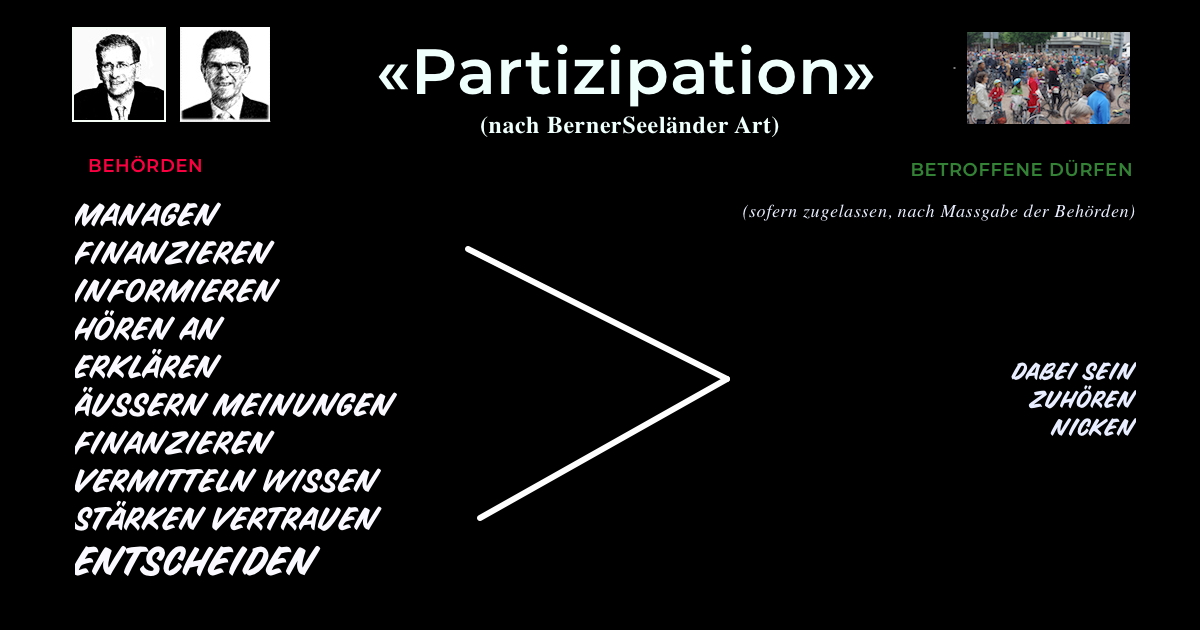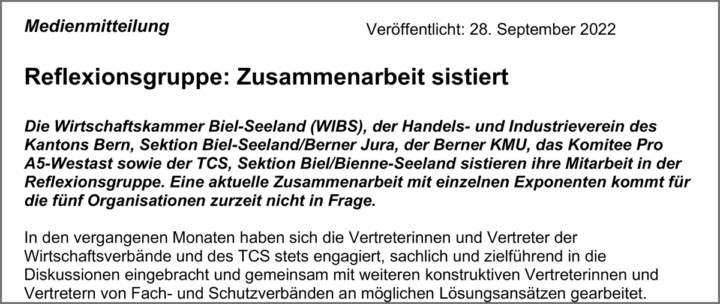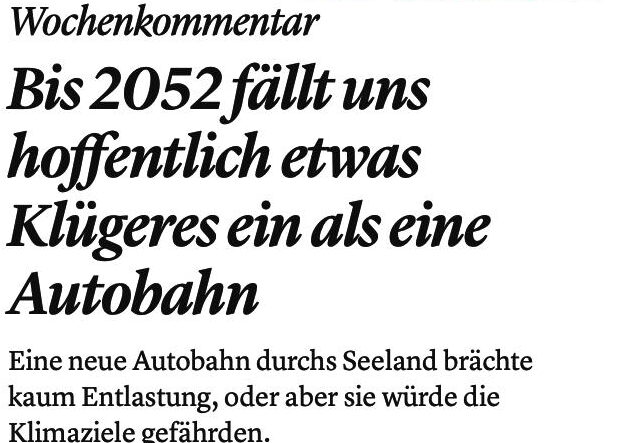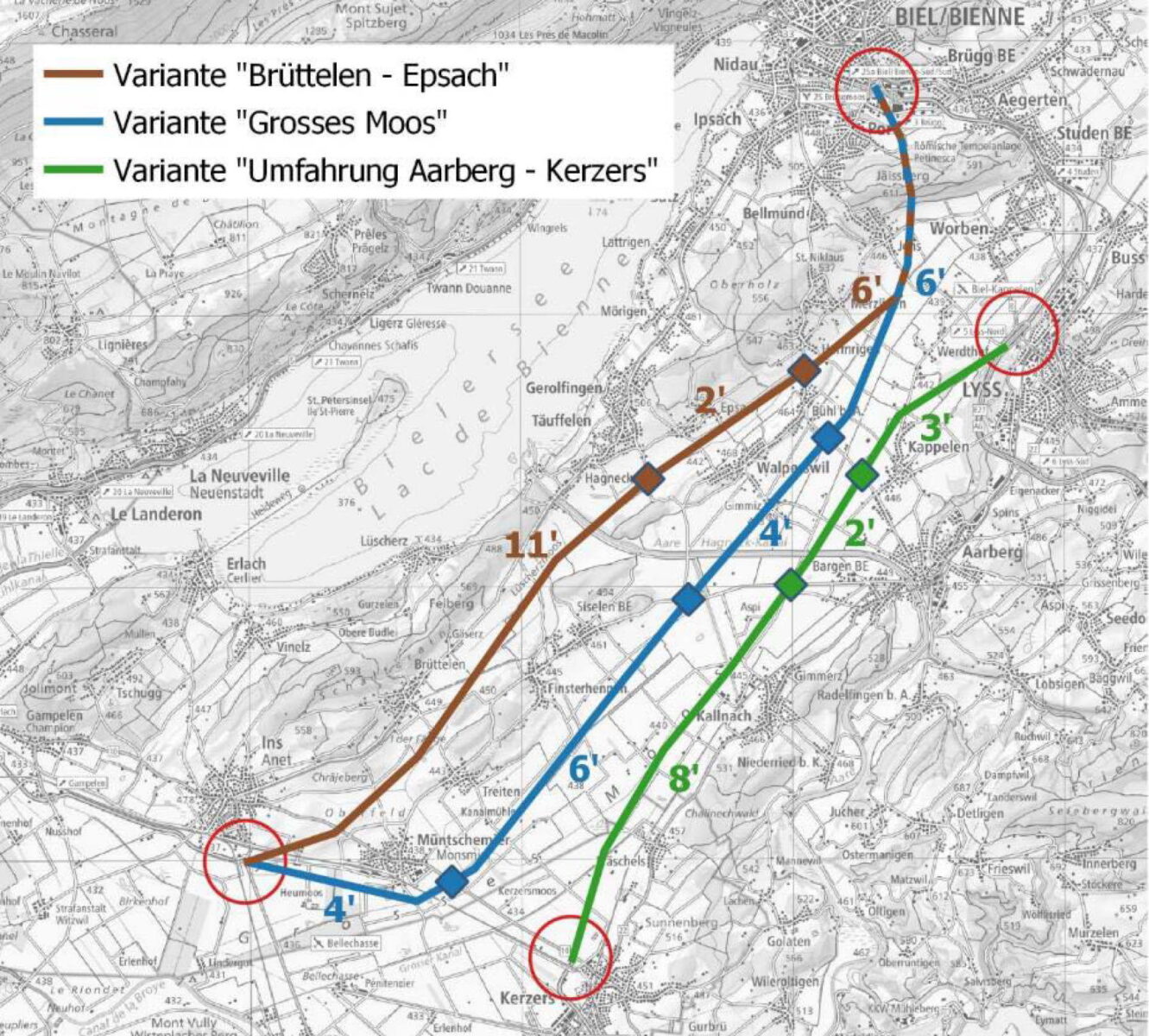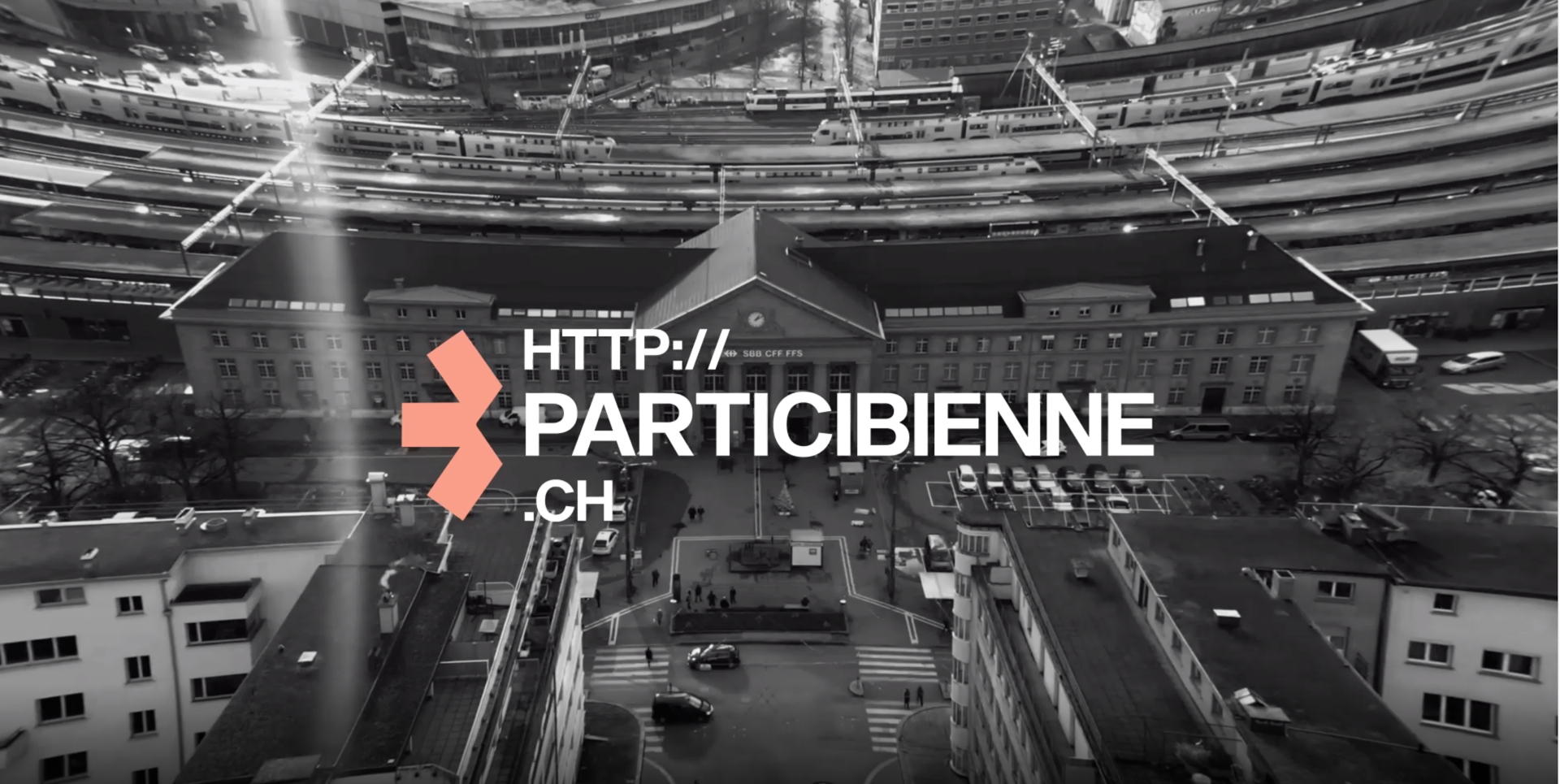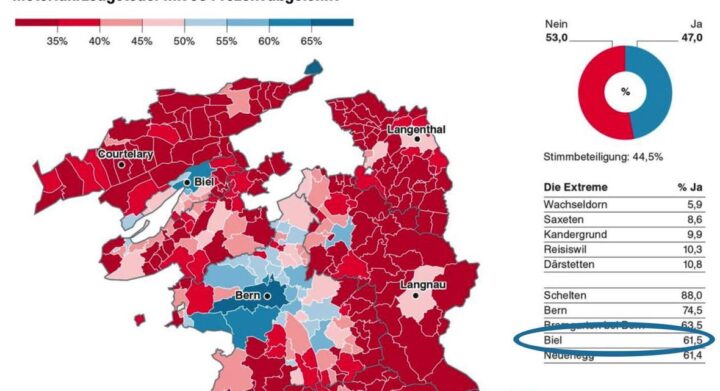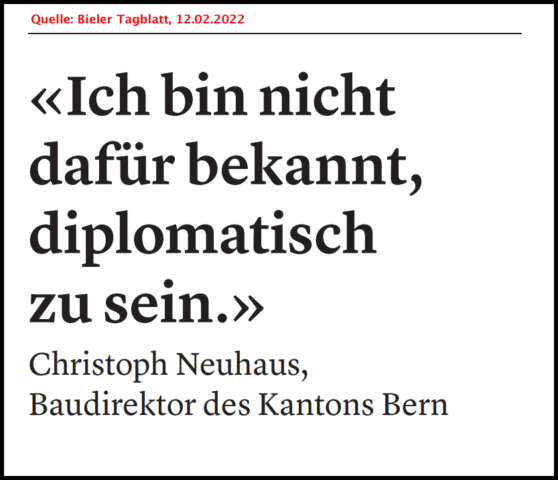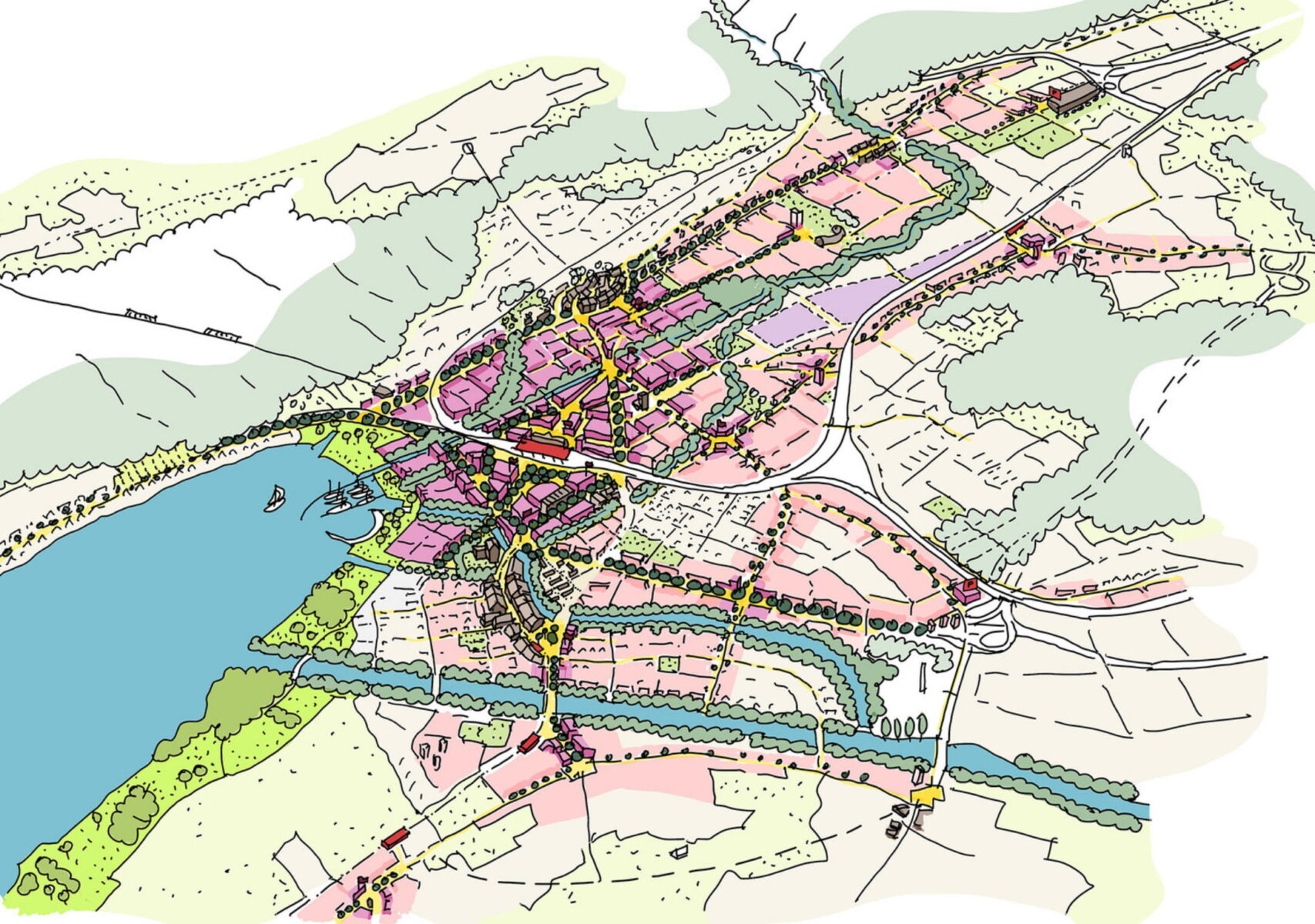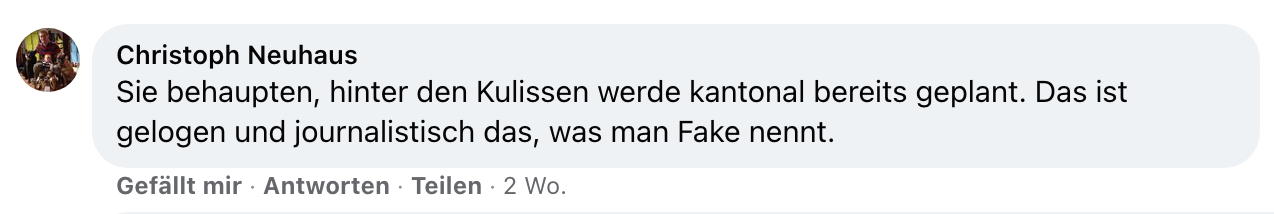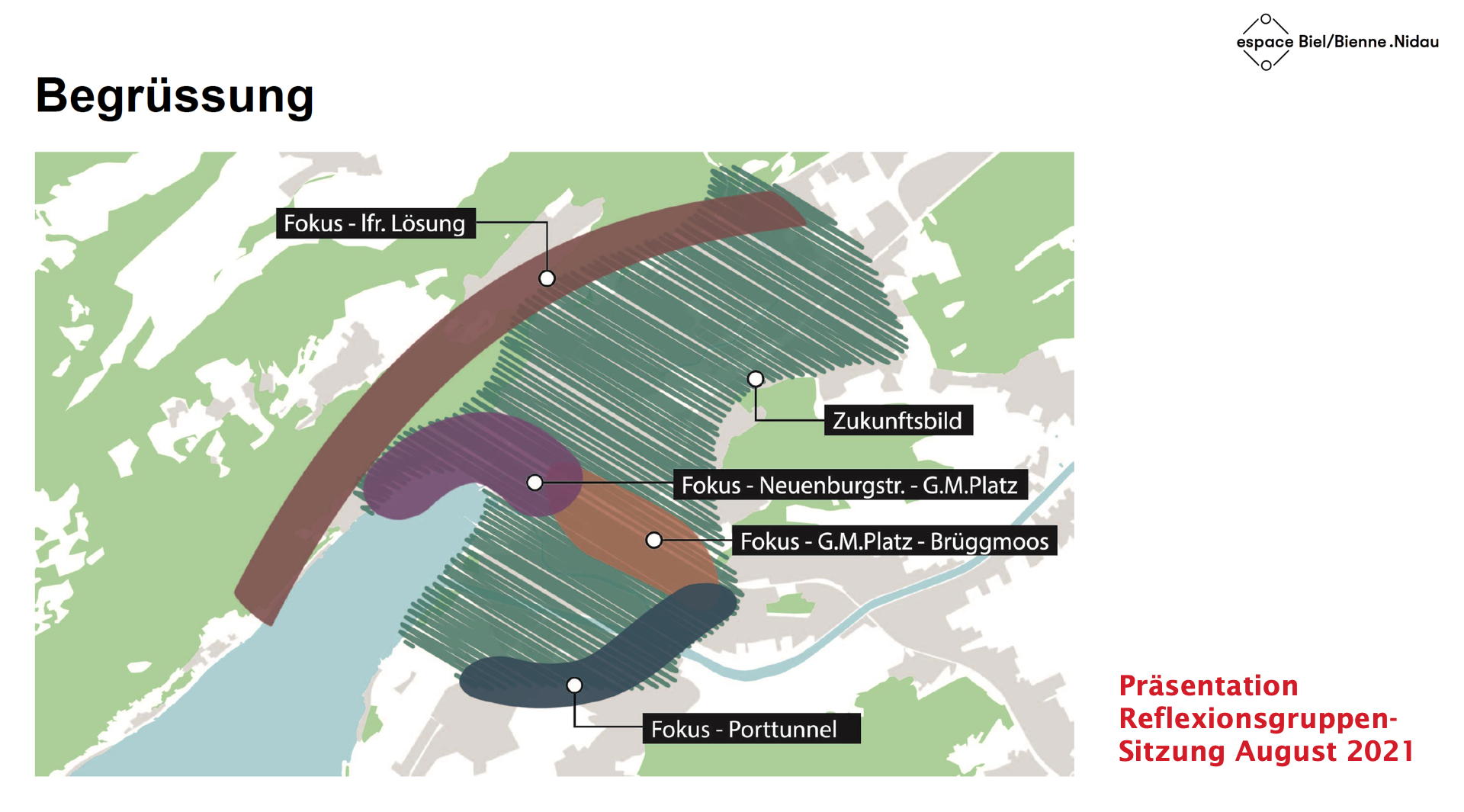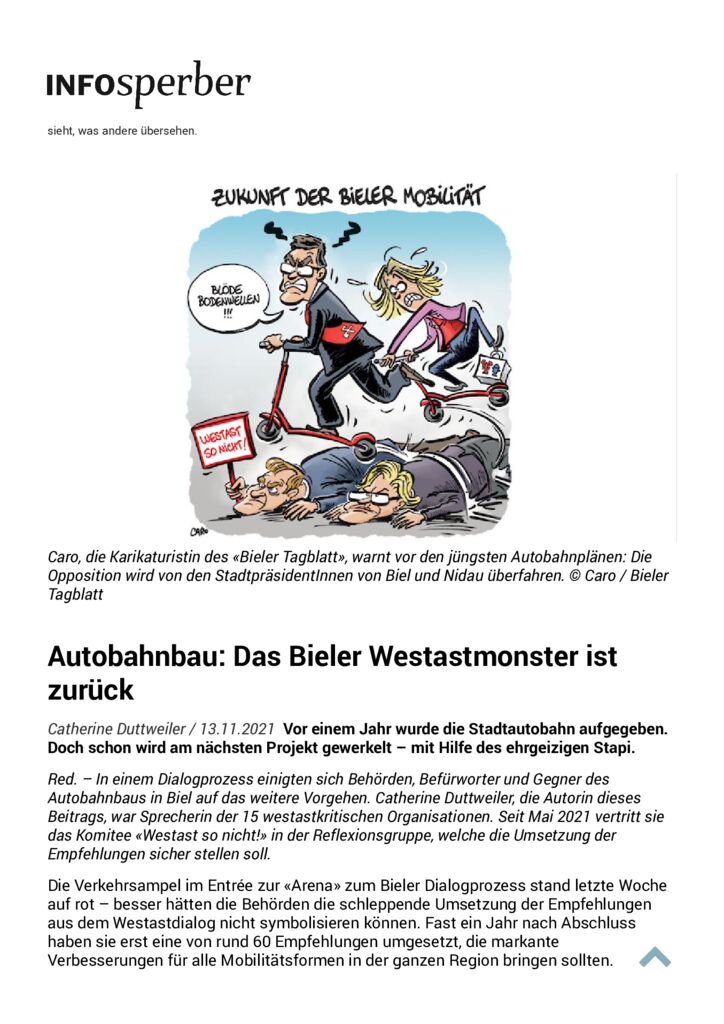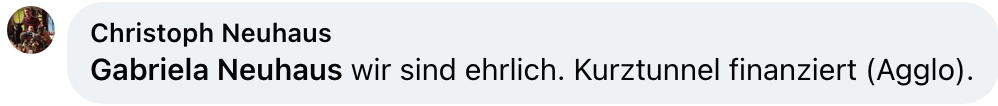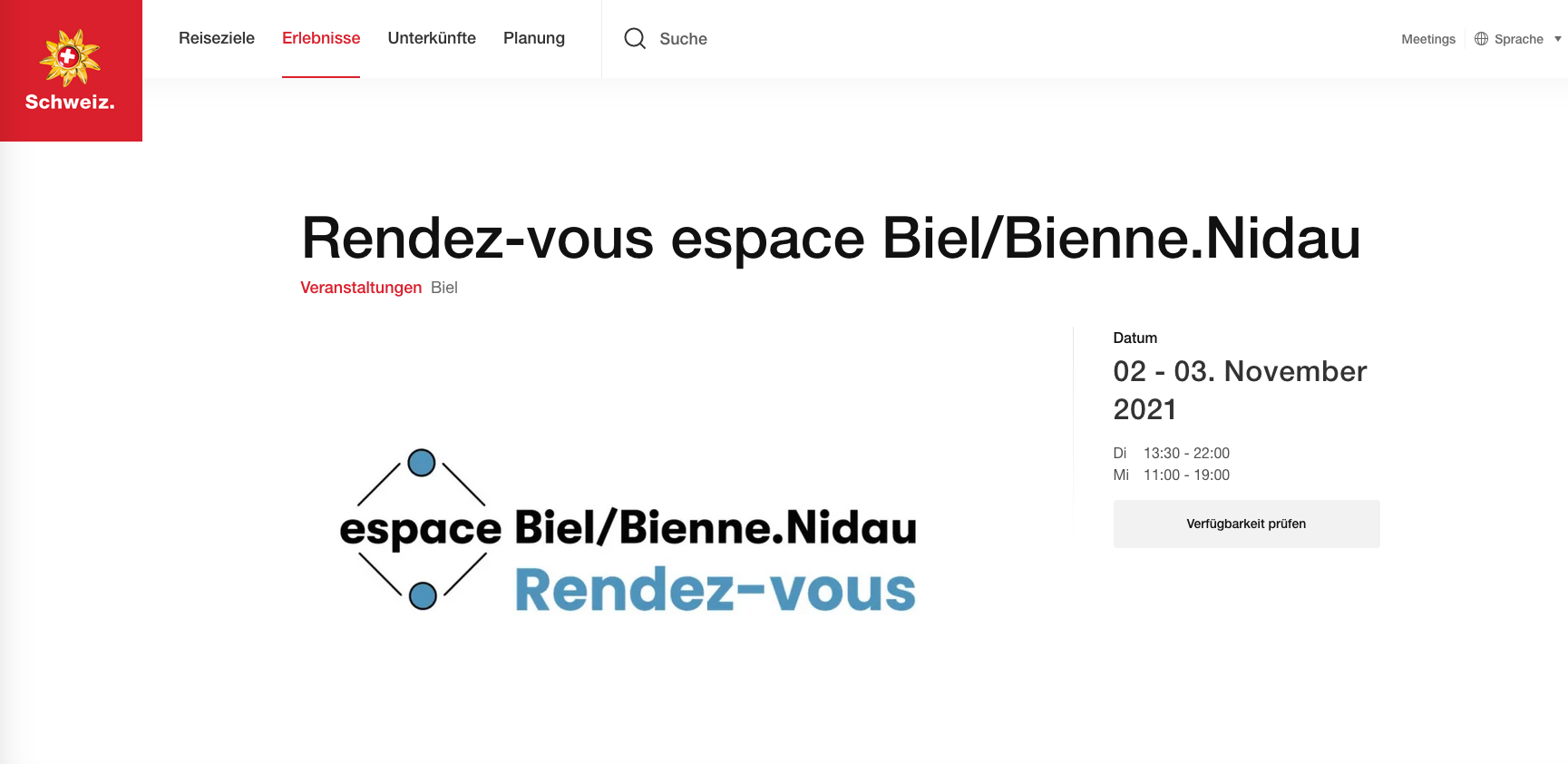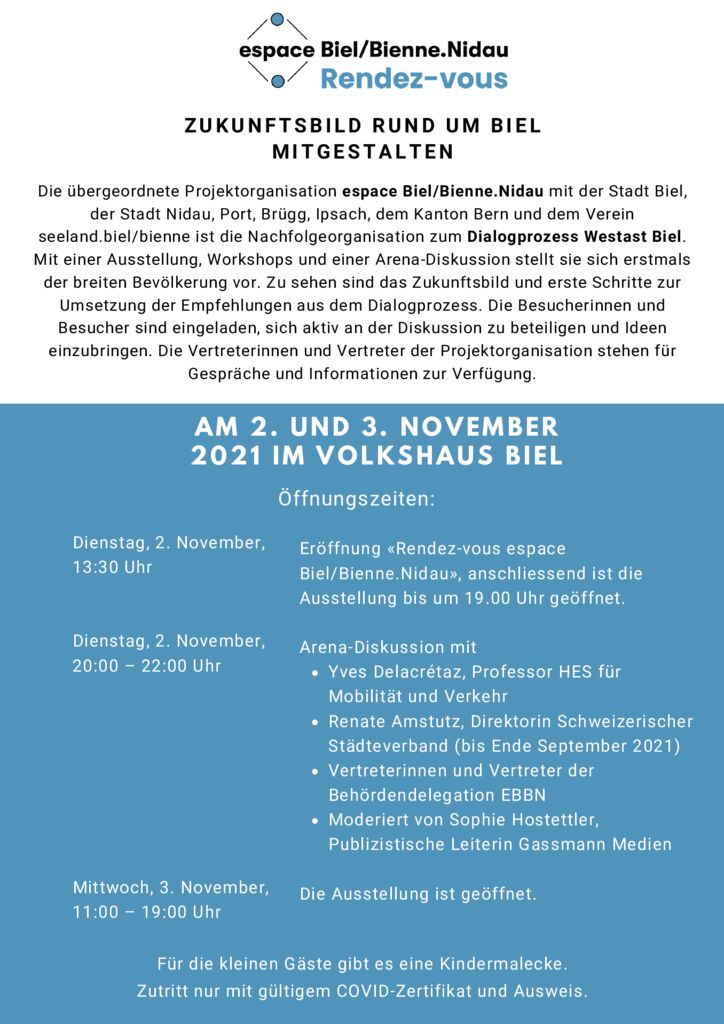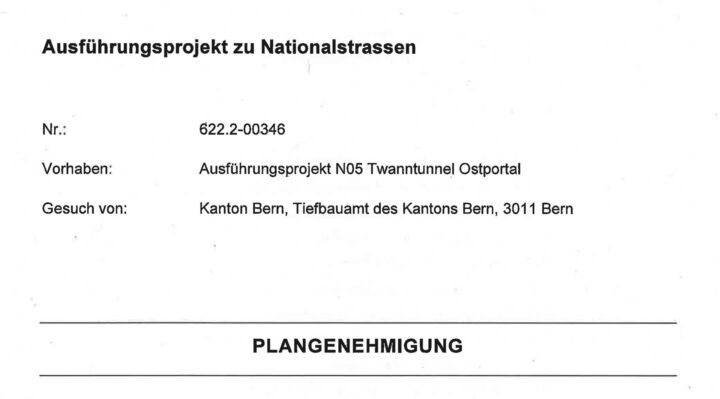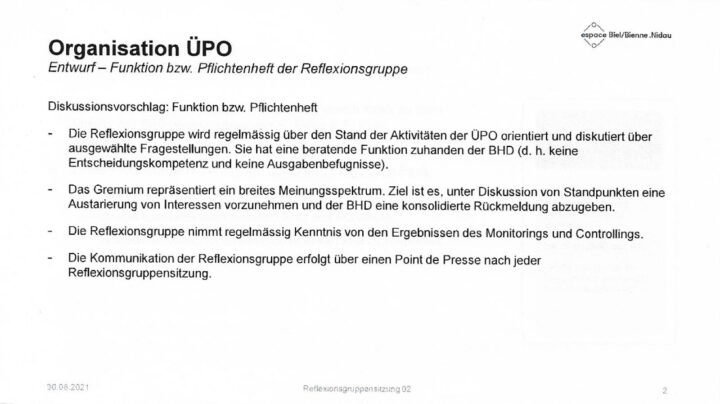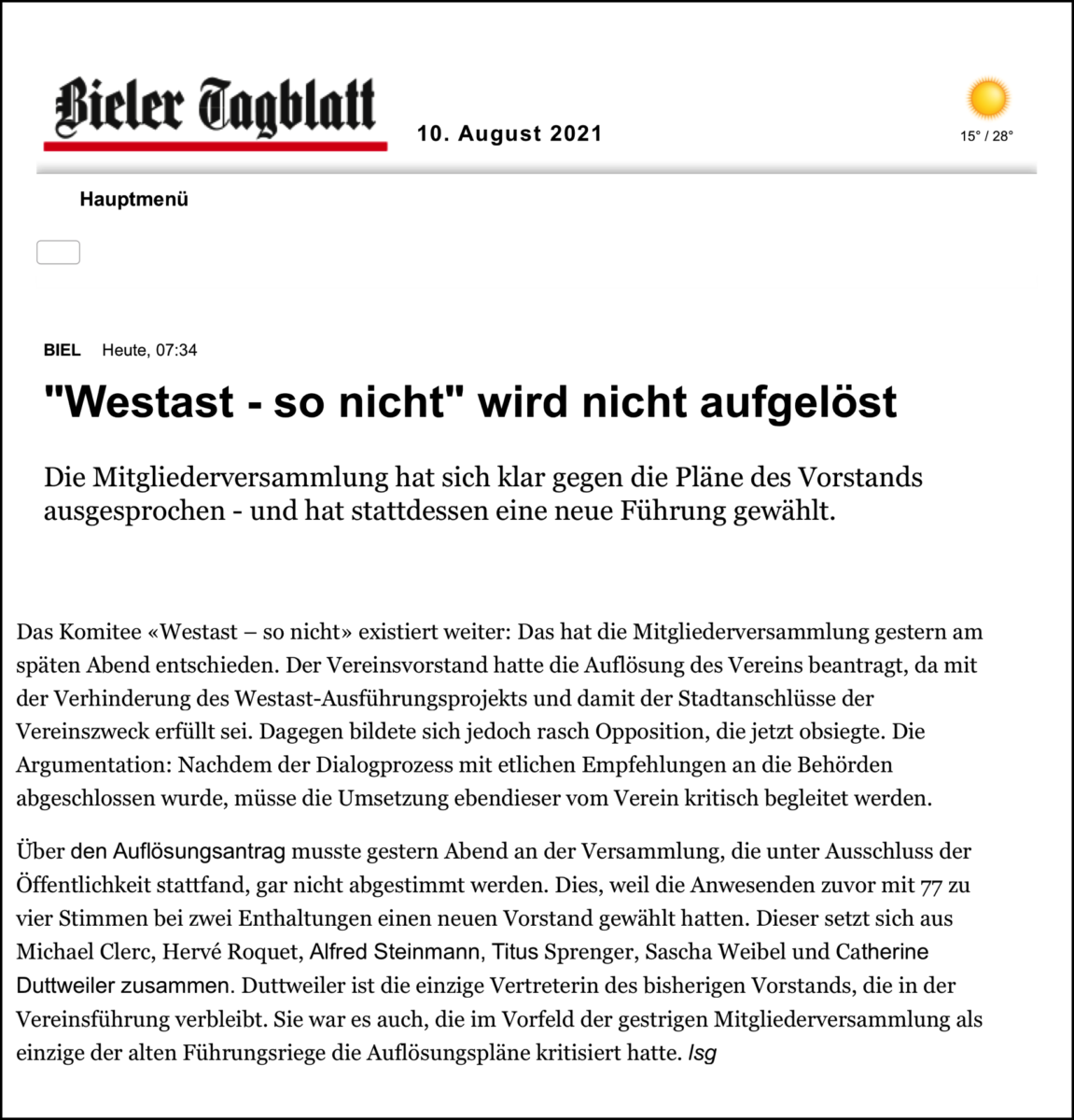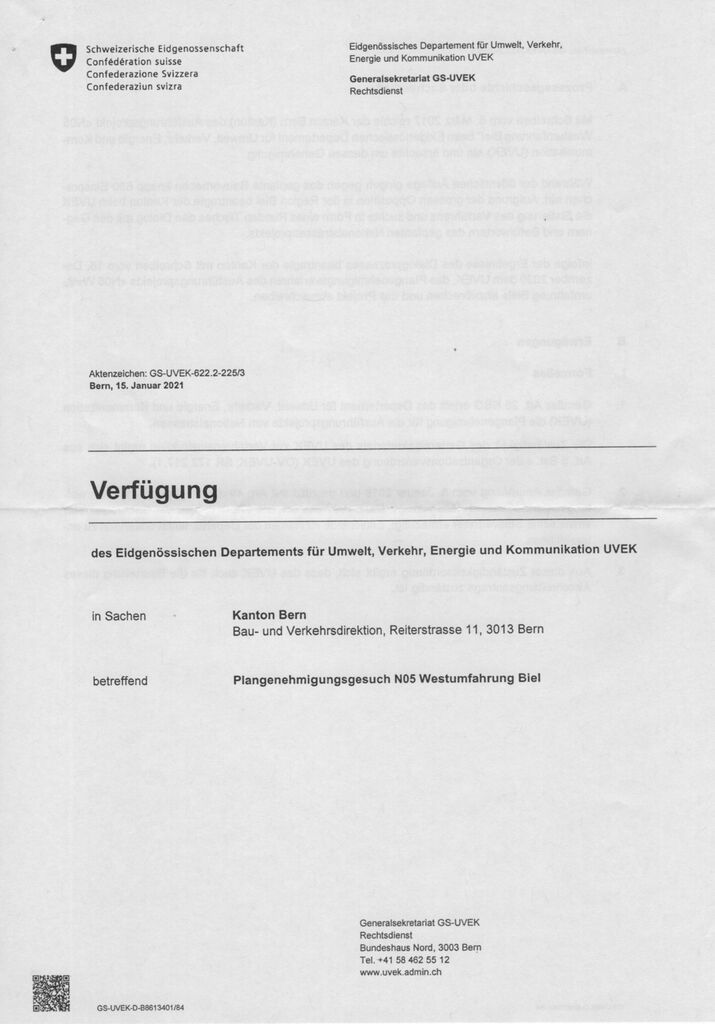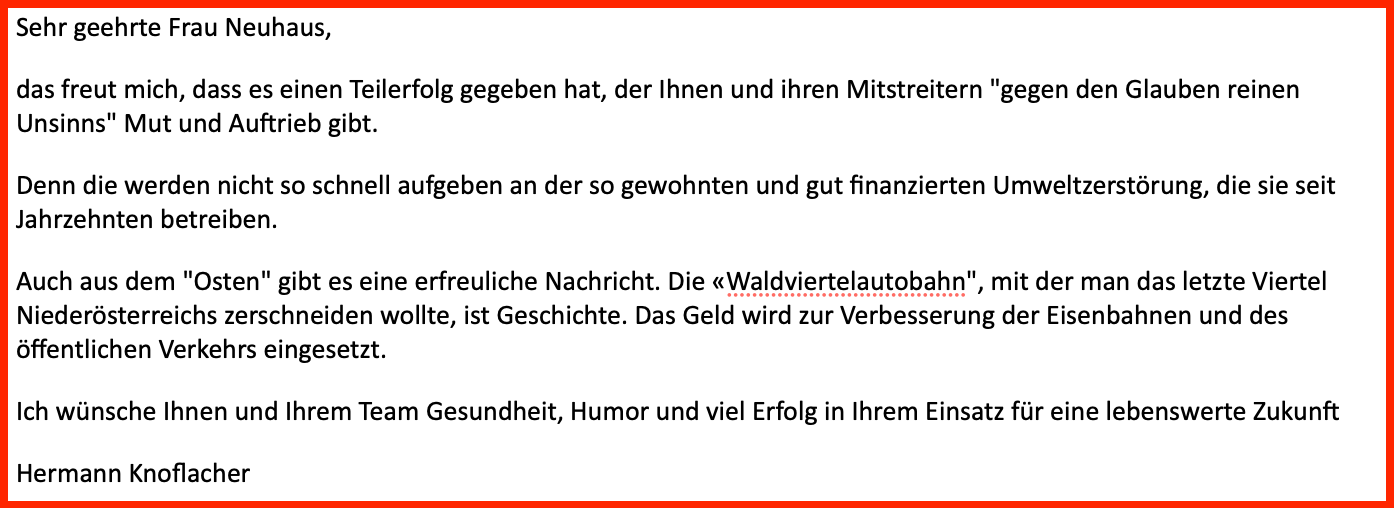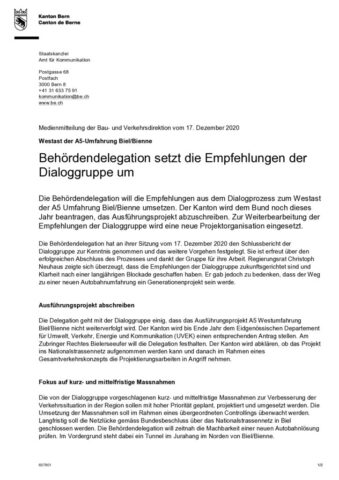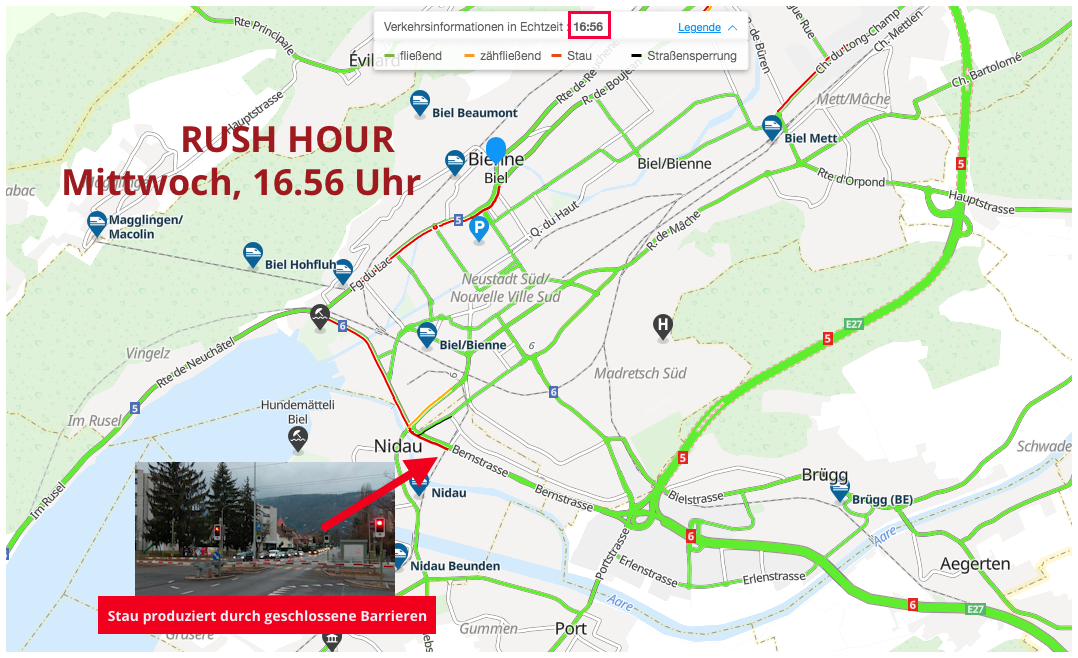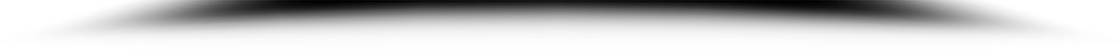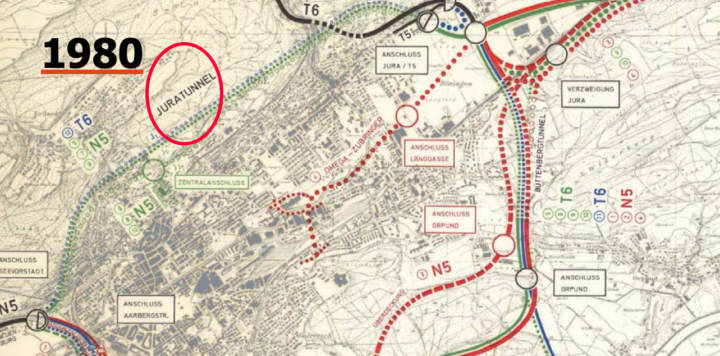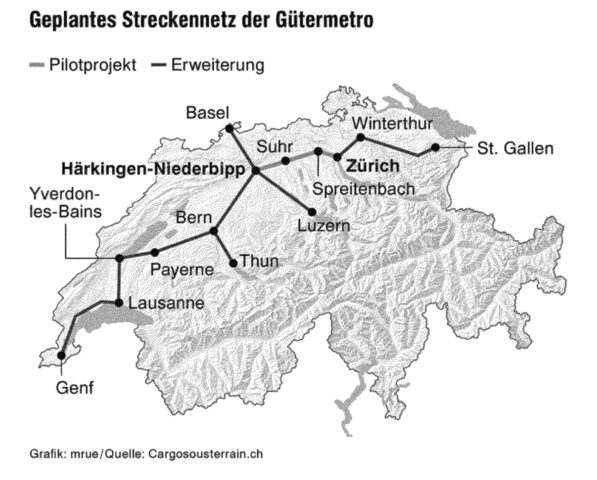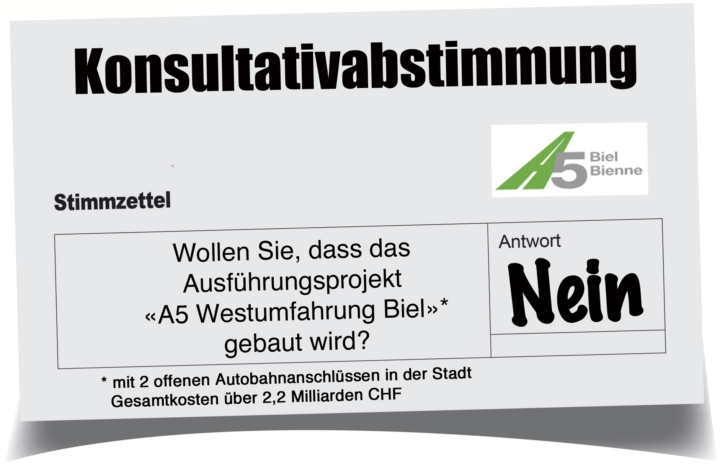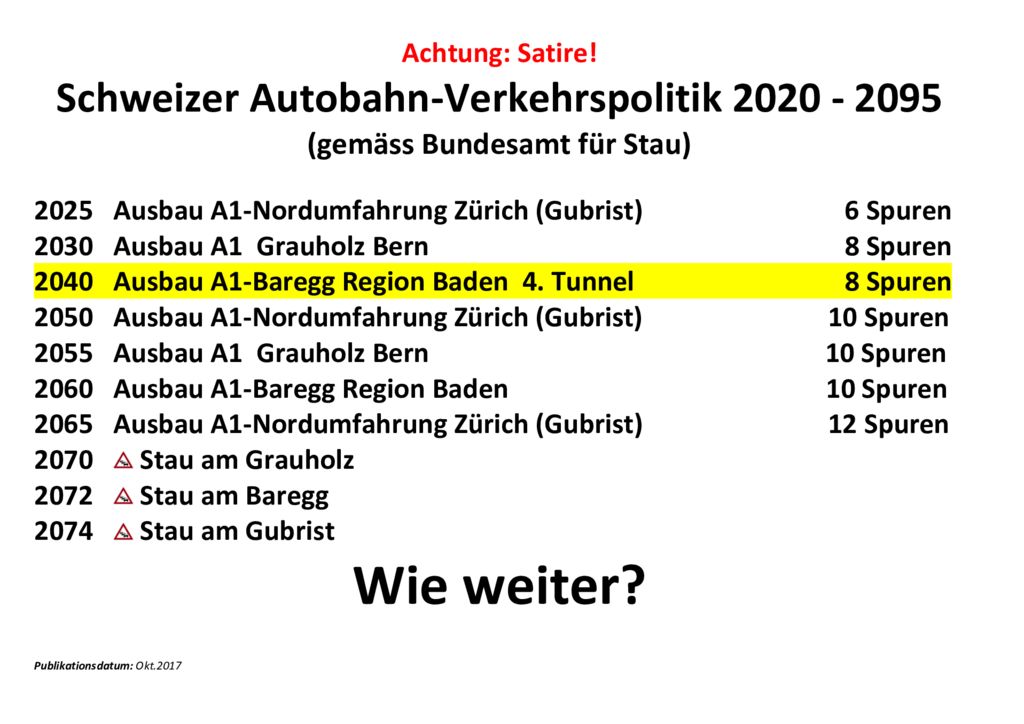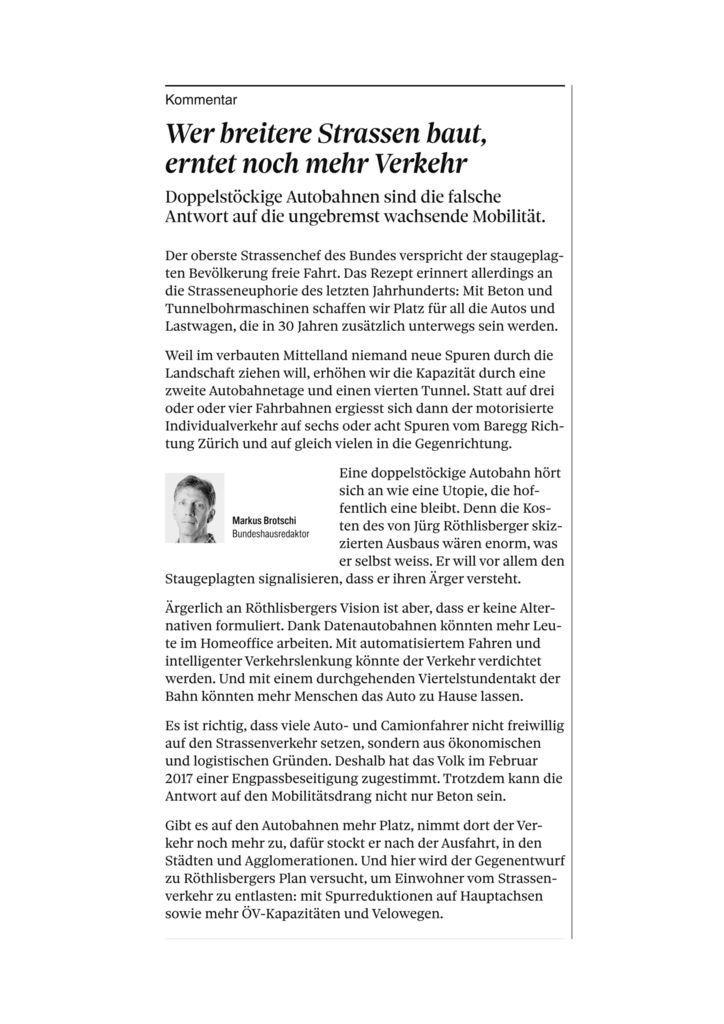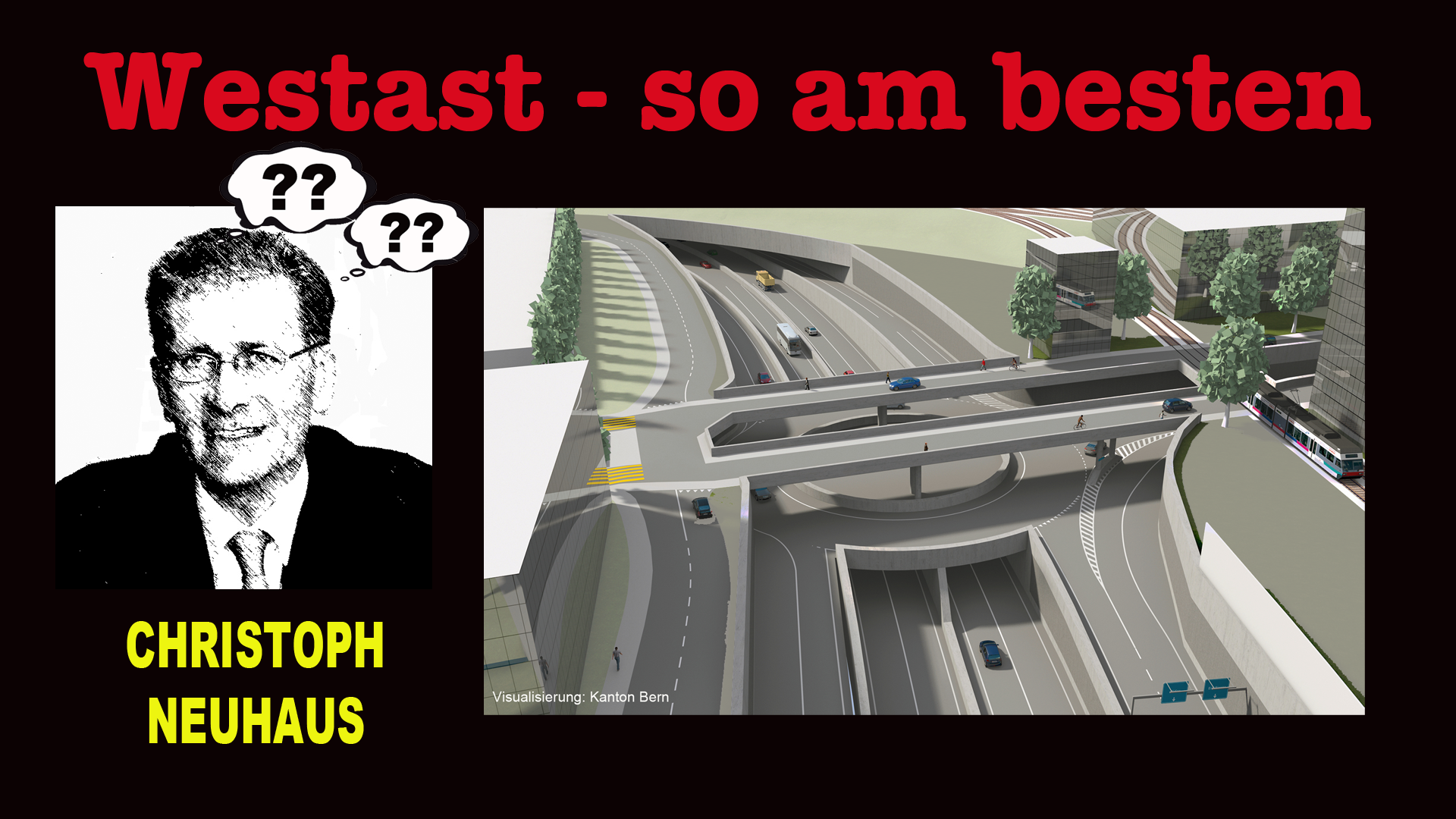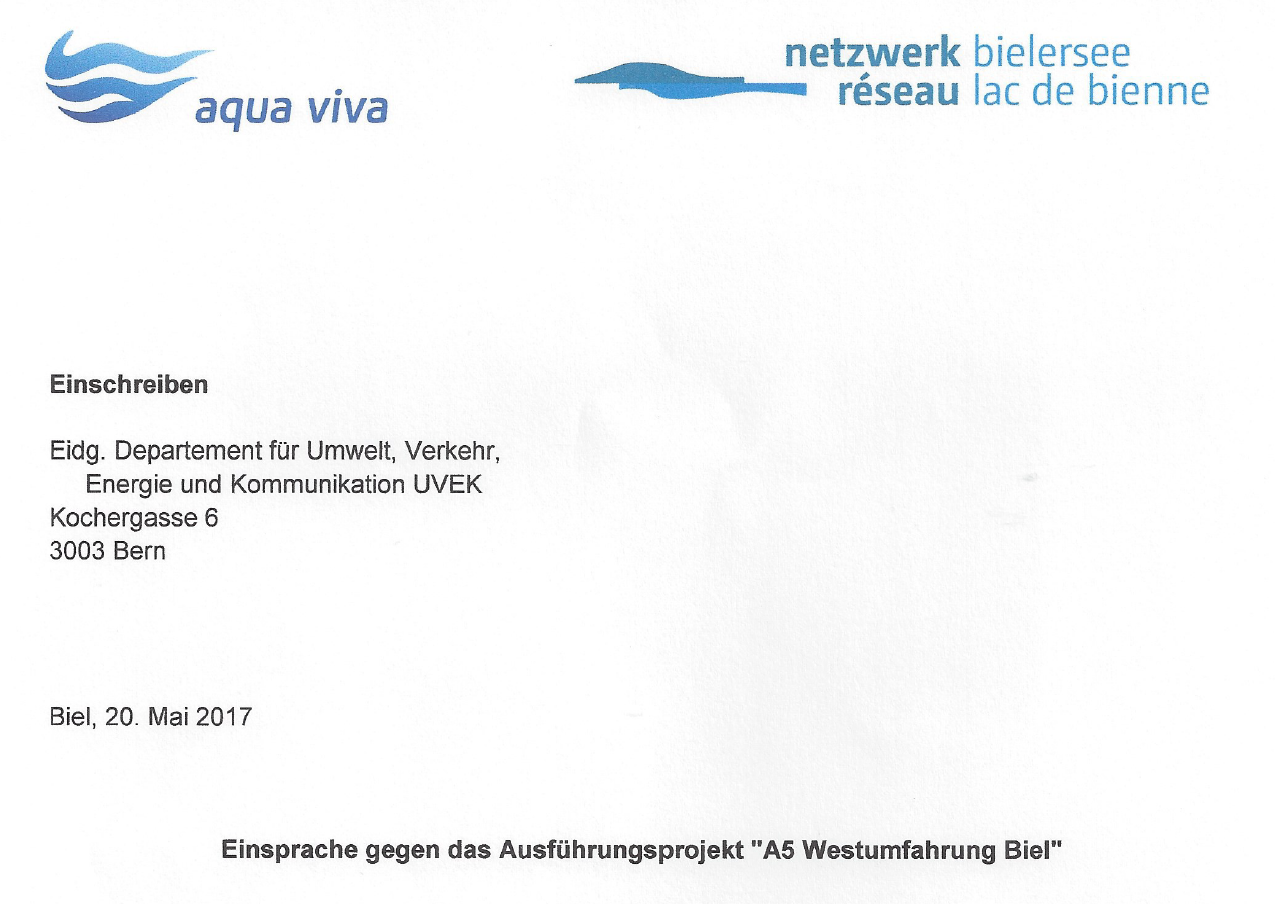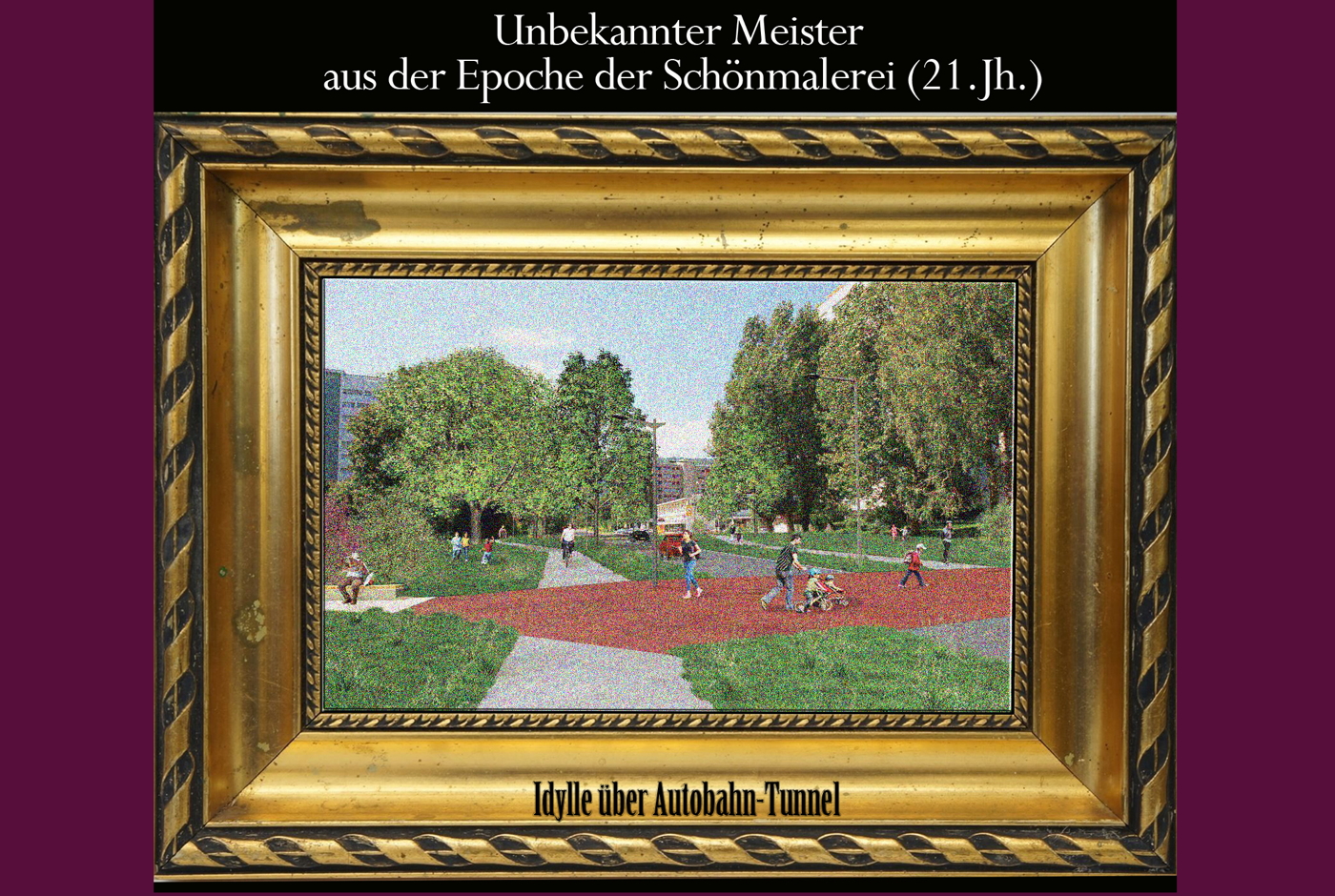NEWS
VERWÜSTUNG IN RATEN
Ein Herbstspaziergang, der nachdenklich stimmt: Schon bald soll der schöne Rebhang von Wingreis zur Baustelle mutieren, das Ostportal für den Twanntunnel wird anschliessend die Landschaft dauerhaft verschandeln.
Ein Skandal, wenn man bedenkt, dass die Reblandschaft am Nordufer des Bielersees zu den ersten geschützten Landschaften der Schweiz gehört. Bereits 1933 gründeten weitsichtige Menschen den Verein Bielerseeschutz (VBS) mit dem Ziel, das einmalige Natur- und Kulturerbe der Bielerseeregion nachhaltig zu schützen.
Einiges ist gelungen. Allerdings konnte der Verein den schlimmsten «Sündenfall» – den Ausbau von Strasse und Bahn entlang dem engen Nordufer in den 1970er Jahren nicht verhindern…

Im 1973 publizierten Bielerseebuch des Vereins bedauert dieser denn auch, dass er den Bau der Strasse nicht verhindern konnte. Und fragt:
«Was bringt die Zukunft? Niemand kann es wissen. Die Aufgaben des VBS werden vermutlich wachsen statt schwinden. An Arbeit wird’s nicht fehlen. Oberstes Ziel bleibt, den Bielersee und seine Umgebung so zu erhalten und so zu gestalten, dass die Bevölkerung Freude daran haben kann, und diesen Quell der Freude der Bevölkerung auch zugänglich zu machen.»
50 Jahre später wissen wir: Keine Patina kaschiert die Bausünden der Vergangenheit – im Gegenteil: Es kam und kommt immer schlimmer…
INAKZEPTABLE ZERSTÖRUNG
Seit ein paar Wochen haben Annemarie und Ronald Wüthrich traurige Gewissheit: Der juristische Kampf gegen den Twanntunnel ist verloren – die Vertreibung aus ihrem Daheim dürfte somit nur noch eine Frage der Zeit sein…
Im heutigen Bieler Tagblatt äussert sich Ronald Wüthrich mit bewegenden Worten zu dieser ebenso traurigen wie unglaublichen Geschichte: Wüthrichs Haus – Baujahr 1947 und in bestem Zustand – wird dem Twanntunnel geopfert und abgerissen, weil das Astra genau auf diesem Grundstück den Bauinstallationsplatz fürs Twanntunnel-Ostportal einrichten will.
Das schmucke Haus mit dem schönen Garten soll Parkplätzen für die Bauarbeiter geopfert werden. Ein Skandal ohnegleichen – zu hoffen ist einzig, dass hier trotz allem noch nicht das letzte Wort gesprochen ist…

TEMPO 30
Endlich wieder einmal eine gute Verkehrsnachricht aus Biel: Alfred Steinmann hat zusammen mit Mitstreiter:innen im Stadtrat eine Motion eingereicht, die flächendeckend Tempo 30 in der ganzen Stadt verlangt.
Das ist sehr begrüssenswert. Nur mit einer breitflächigen Drosselung der Geschwindigkeit für den motorisierten Verkehr (inklusive E‑Bikes!) kann der öffentliche Raum für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer und attraktiv gestaltet werden!
Wo Tempo 30 bereits eingeführt wurde zeigt sich: Der Lärm nimmt genauso ab wie die Hektik auf der Strasse. Vor allem aber können sich alle sicherer fühlen. Deshalb fordert denn auch der Schweizer Städteverband, dass Tempo 30 im Siedlungsgebiet zur Norm wird.
Ein Trend, der längst nicht mehr «revolutionär» ist: In Spanien gilt bereits seit 2021 Tempo 30 als neue Standardgeschwindigkeit in den Städten. Auch in Holland wurde die Regelgeschwindigkeit in Städten auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.
Warum sollte dies also nicht auch in Biel möglich sein? Zumal die Beschränkung auf 30 km/h auf dem gesamten Stadtgebiet etwa den Transitverkehr, der sich immer noch mitten durch Biel zwängt, reduzieren könnte. Gepaart mit einem Transitverbot für den Schwerverkehr hätte dies enorme positive Auswirkungen.
Die Motion dürfte spätestens im Frühjahr 2024 im Stadtrat zur Abstimmung kommen. Man darf hoffen, dass danach einer zügigen Umsetzung nichts mehr im Weg stehen wird!
AUF NACH TWANN!
«Twanntunnel kann gebaut werden» – so die Medienmitteilung des Kantons Bern vom 9. Oktober 2023. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die wenigen verbliebenen Einsprachen gegen das Monsterprojekt abgeschmettert – ein Weiterzug bis ans Bundesgericht schien aussichtslos.
Damit sei das Auflageprojekt für das geplante Ostportal in Wingreis rechtskräftig, so der Kanton. Ab jetzt liegt die Federführung für das Projekt einzig und allein beim Bundesamt für Strassen ASTRA – der Kanton werde sich dort aber «für eine rasche Realisierung des Tunnels einsetzen, damit das Dorf Twann möglichst bald vom Durchgangsverkehr befreit wird.»
Ein schwarzer Tag für die geschützte Reblandschaft am Bielersee Nordufer. Fakt ist, dass das geplante Bauprojekt eine weitere, unheilbare Wunde in die Seeländer Kulturlandschaft schlägt. Und dies in unmittelbarer Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Weiler Wingreis.
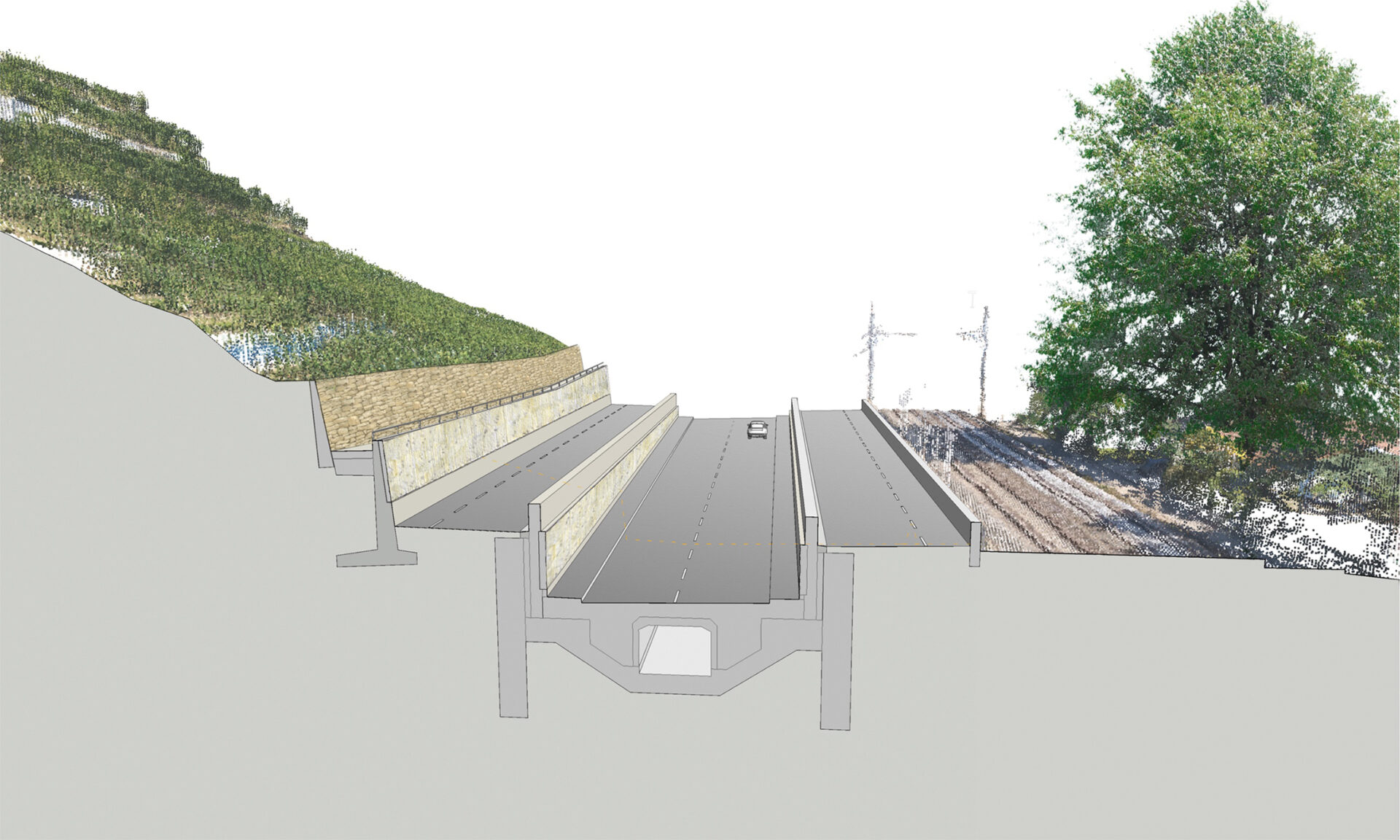 ©Tiefbauamt Kanton Bern
©Tiefbauamt Kanton Bern
Statt die Verkehrsbelastung am linken Bielerseeufer mit zeitgemässen Lenkungsmassnahmen wie etwa einem Transitverbot für den Schwerverkehr sowie einer dauerhaften Temporeduktion auf maximal 60 km/h zu bekämpfen, soll das fragile Ufer mit einem weiteren Betonelement verschandelt werden.
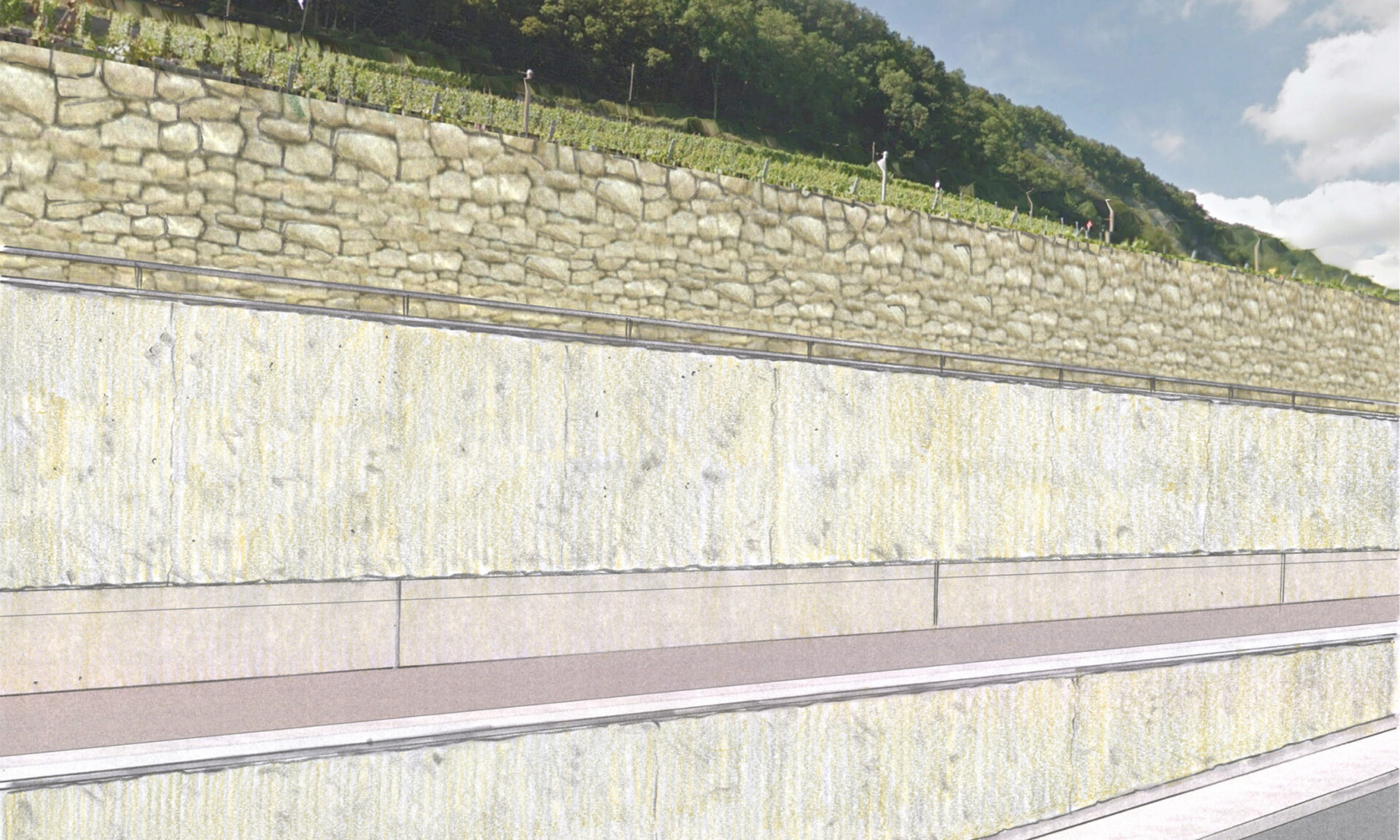 ©Tiefbauamt Kanton Bern
©Tiefbauamt Kanton Bern
Was man sich damit längerfristig einhandelt, zeigen die aufwändigen und teuren Renovationsarbeiten entlang der Strecke zwischen Biel und Twann, die auch nach zwei Jahren zu keinem Ende kommen. Mit dem Twanntunnel wird diese unglückliche Pflästerlipolitik ad infinitum fortgesetzt. Immer mehr Unterhaltsaufwendungen werden den Steuernzahlenden aufgebürdet: unvermeidliche Folgekosten, die im Zusammenhang mit den reinen Baukosten nie ausgewiesen werden.
Ein trauriger Triumph der Ewiggestrigen. Es sind überwiegend alte Männer, die sich in und um Twann damit rühmen, 30 Jahre lang für diesen Tunnel gekämpft zu haben. Ihnen stehen junge Familien aus Twann gegenüber, die sich gegen die Verschandelung ihrer Heimat wehren. Allen voran die Winzerin Anne-Claire Schott – ihr geht es dabei nicht nur um die Unversehrtheit ihrer Demeter-Reben, sondern auch um die Zukunft ihrer Kinder.
 ©TeleBielingue, 9.10.2023
©TeleBielingue, 9.10.2023
Damit ist sie nicht allein. Umso stossender ist, dass sich der (ziemlich graumelierte) Twanner Gemeinderat wie sämtliche andere Behörden den Wünschen und Forderungen jener, denen die Zukunft gehört, verschliessen.
Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Wie im Kampf gegen den Westast, lautet auch hier das Motto: Sich wehren, bis die Bagger auffahren. Anne-Claire Schott und ihre Mitkämpfer:innen setzen nun darauf, das Projekt auf politischem Weg zu verhindern, um die Reblandschaft von Wingreis zu retten.
Eine Herkulesaufgabe, die das Komitee «N5 Bielersee – so nicht!» alleine nicht schafft. Es geniesst zwar in Twann einiges an Rückhalt – aber im Kampf gegen das ASTRA und den Kanton reicht das niemals. Was die Tunnelgegner:innen aus Twann jetzt dringend brauchen, sind entschlossene und engagierte Verbündete. Bislang ernteten sie zwar von Seiten der ehemaligen Westast-Gegnerschaft immer wieder lobende Worte und Sympathie. Mehr nicht.
Den grössten Support haben die Schützerinnen und Schützer des Bielerseeufers in den letzten Tagen notabene aus den Medien erhalten: Brigitte Jeckelmann stellt in ihrem klugen und sehr lesenswerten Wochenkommentar im Bieler Tagblatt vom 30. September fest und fordert: «Der Twanntunnel ruiniert die geschützte Landschaft. Es braucht den Mut, Alternativen ernsthaft zu prüfen.»
Damit dies geschieht, braucht es jetzt eine Parforceleistung. Einzig ein Widerstand, wie er in Biel gegen den Westast möglich wurde, kann die Fortsetzung des Beton-Wahnsinns am Bielersee Nordufer noch verhindern.
Deshalb der Aufruf auch an alle Bielerinnen und Bieler, ans immer noch bestehende Komitee Westast-so-nicht und an all jene, denen Klima, Biodiversität und die Zukunft unserer Region am Herzen liegen: Auf nach Twann! – Damit die N5 nicht definitiv zu einer Dauerbaustelle mutiert – und das Naherholungsgebiet nicht weiter zerstört wird!
TeleBielingue vom 9. Oktober 2023: Ewiggestrige ohne Gespür für die Anliegen junger, engagierter Twanner:innen:
GROSSE PLÄNE – K(L)EINE WIRKUNG

Anfang Oktober 2023 luden die Städte Biel und Nidau gemeinsam mit der Baudirektion des Kantons Bern zur Medienkonferenz. Mit viel Tamtam lancierten die Behörden das Projekt «Rue de Caractères» – gemeint ist die seit dem Westast-Dialog angekündigte Umgestaltung der Verkehrsachse von der Neuenburgstrasse über die Ländte‑, Aarberg- und Bernstrasse bis zum Anschluss Brüggmoos.
Die Federführung obliegt der extra für die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Westast-Dialog gegründeten Organisation Espace Biel/Bienne.Nidau EBBN. Für die Bieler Medien posierten Erich Fehr – bekannt als jahrelanger Westast-Turbo und noch bis im Frühjahr 2024 Bieler Stadtpräsident und Claudia Christiani, Kreisoberingenieurin beim Bieler Tiefbauamt, auf einer Ländtestrasse ohne Autoverkehr.
Vom so oft zitierten und immer wieder herbeigeredeten Verkehrschaos war nichts zu sehen – die «wichtige Verkehrsachse» präsentierte sich – wie immer ausserhalb der Stosszeiten – äusserst verkehrsarm. Trotzdem soll hier dereinst mit grosser Kelle angerichtet werden. Um die «heute vom motorisierten Verkehr dominierte Strasse für alle Verkehrsträger» aufzuwerten, wie es in der Medienmitteilung heisst.
Was und in welchem Rahmen umgestaltet werden soll, bleibt allerdings verborgen. Die Umsetzung von Massnahmen wie etwa eine Temporeduktion oder ein Transitverbot für den Schwerverkehr, die bereits im Westast-Dialog vorgeschlagen wurden, wird weiter aufgeschoben. Einzig die Bernstrasse hat mittlerweile einen «Flüsterbelag» erhalten – ob und inwiefern die Anwohnerinnen und Anwohner davon etwas gemerkt haben, hat bisher niemanden interessiert.
Dafür soll jetzt zwei Jahre lang für teures Geld weiter evaluiert, partizipiert, gefordert und geträumt werden. Ganze 1,24 Millionen Franken wollen die beiden Städte und der Kanton verbraten, um herauszufinden, wie die Achse Bernstrasse-Neuenburgstrasse «vom Durchgangsraum zum Lebensraum» zu verwandeln wäre. Also eine Achse, die keine Achse mehr sein soll, aber eine Achse bleiben muss.
Dafür haben die Verantwortlichen nicht weniger als fünf (!) Kommunikations- und Werbeagenturen angeheuert. Die Büros aus Bern und Biel decken eine breite Palette von Philosophien ab, damit sich alle Interessengruppen vertreten fühlen dürfen. Ganz nach dem Motto: Fehlt es Politik und Verwaltung an Ideen, übergeben sie das Ruder den «Kreativen».
Das grosszügige Budget trägt bereits erste Früchte: So wurde aus der Achse Neuenburgstrasse-Bernstrasse kurzerhand die Rue de Caractères. In Klammern würden wir als sechste Agentur im gleichen Stil (unbezahlt) zufügen: C’est l’étiquette, qui fait la musique.
Noch besser: Die Werber:innen haben mit ihren Zeichnungen die Rue de Caractères bereits in ein regelrechtes Paradies verwandelt, wo ein vergnügtes Sünneli auf fröhliche Menschen und Tiere herunter lacht. Die Autos sind niedlich anzusehen, und der einzige Lastwagen am Rand des Bildes fände problemlos im ebenfalls abgebildeten Lastenvelo Platz.
 ©Stadt Biel, Stadt Nidau, Kanton Bern
©Stadt Biel, Stadt Nidau, Kanton Bern
Das alles soll – gross aufgemacht auf einer Extra-Website sowie auf riesigen Plakatwänden in Biel und Nidau – die Bevölkerung dazu animieren, ihre Wünsche und Ideen für die künftige «Rue de Caractères» kundzutun.
Diese Partizipationspflichtübung wird richtig teuer: In den kommenden Wochen ist die Bevölkerung erst einmal eingeladen, an Quartierspaziergängen und Velotouren teilzunehmen, um ihre Wünsche zu äussern und online Fragebögen auszufüllen.
Anfang 2024 sollen dann – in einer weiteren Online-Umfrage – Erwartungen formuliert und die Aufgabenstellung entsprechend konkretisiert werden. Darauf folgt als dritter Schritt die Erarbeitung von Vorschlägen in «interdisziplinären Expertenteams» sowie ein Workshop und wiederum Online-Umfragen zu den Vorschlägen.
In einem vierten Schritt sollen dann die Ergebnisse aus den vorherigen Phasen in einer Ausstellung präsentiert und eine weitere Online-Umfrage dazu gestartet werden…
Bleibt die Frage, wer an diesem Prozess partizipieren wird, und wieviel davon dereinst in ein Ausführungsprojekt einfliessen wird. Hier kann man nur diagnostizieren: EBBN hat aus bisherigen Flops und Fehlern nichts gelernt…
Noch keine zwei Jahre ist es nämlich her, dass EBBN mit der Pseudo-Partizipationsveranstaltung «Rendez-vous» eine Totgeburt lancierte und entsprechend Kritik erntete. «Die Besucher waren eingeladen, wieder von vorne anzufangen, ihre Ideen, Visionen und Anregungen zu notieren und sich auf die Suche zu machen nach einer thematisch verwandten Posterwand, um die bunten Zettel dort anzuheften», fasste etwa ein Leserbriefschreiber damals zusammen. Er gehörte zu den wenigen, die überhaupt den Weg in besagte Ausstellung auf sich genommen und einer Debatte beigewohnt hatten…
Und nun also wieder von vorne:
Eine Alibiübung, deren einziges Resultat sein dürfte, dass schnell erreichbare Verbesserungen, etwa durch ein Transitverbot für den Schwerverkehr, fussgängerfreundlichere Schaltung von Verkehrsampeln, eine velo-gerechte Verkehrsführung oder eine generelle Temporeduktion auf unbestimmte Zeit hinaus aufgeschoben werden.
Der Kredit von 1,24 Millionen Franken, der diesen Stillstand besiegelt, wurde von den Stadtparlamenten durchgewinkt. Die einen sagten ja, weil sie – als Resultat aus dem Westast-Dialog – auf die «Gesamtmobilitätsstudie» und den Juratunnel setzen. Die anderen, weil 1,24 Millionen an PR-Agenturen weniger Schaden anrichten, als wenn sie in Strassenbau investiert werden.
Was hingegen nach wie vor gänzlich fehlt, sind kluge Ideen, wie sich die Stadt Biel – auch entlang der Verkehrsachse Neuenburgstrasse-Brüggmoos – entwickeln könnte.
1,24 Million Steuergeld aus dem Fenster zu werfen, sind bestenfalls eine Idee. Aber eine kluge?
TWANNTUNNEL – EINE ENDLOSE GESCHICHTE

Auf der A5 zwischen La Neuveville und Biel ist der Teufel los. Nach wie vor präsentiert sich die Teilstrecke am Bielersee Nordufer als eine einzige nicht enden wollende Baustelle. Gefährlich, unübersichtlich – und Nerven aufreibend.
Damit nicht genug: Dieser Tage ist publik geworden, dass das Bundesverwaltungsgericht die Einsprachen gegen den Twanntunnel abgeschmettert hat. Da nützt es wenig, dass der Winzerin Anne-Claire Schott in wenigen Punkten Recht gegeben wurde: Laut Verwaltungsgericht muss die Bauherrschaft Rücksicht nehmen auf die Anforderungen der ökologischen Bewirtschaftung ihrer Reben, die in unmittelbarer Nähe der künftigen Autobahn-Baustelle wachsen. Ein Teil ihrer Reben werden dem Tunnelportal geopfert – was die Eigentümerin dafür an Entschädigung erhält, weiss sie bis heute nicht.
Fakt ist: Das Verwaltungsgericht hat alle anderen Einsprachen abgeschmettert – auch jene des Ehepaars Wüthrich, das mit der Erstellung des Installationsplatzes für das Twanner-Monsterprojekt sein Daheim verliert. Damit erhalten der Kanton und das ASTRA grünes Licht, um mit dem Monsterprojekt vorwärts zu machen.
Anne-Claire Schott verzichtet darauf, ihre Einsprache ans Bundesgericht weiterzuziehen. Es sei aussichtslos, kommentiert die Winzerin. Und will sich künftig, zusammen mit ihren Mitstreiter:innen auf den politischen Widerstand gegen das Projekt bauen.
Es ist höchste Zeit, dass sich das Komitee «N5 Bielersee so nicht!» nicht nur vehement und geeint stark macht gegen dieses aus der Zeit gefallene Tunnelprojekt. Viel mehr braucht es dringend die Unterstützung von Verbündeten.
Diese zu finden, sollte eigentlich in Zeiten des Klimawandels nicht weiter schwierig sein. In der Region Biel sind die Menschen seit dem Kampf gegen den Westast sensibilisiert, in Bern hat sich mit dem Verein «Spurwechsel» eine starke Lobby gegen unsinnige Strassenerweiterungen zusammengefunden.
Den Widerstand befeuern müsste zudem der Fakt, dass mit dem Bau des Twanntunnels das Nordufer des Bielersees definitiv zu einer Dauerbaustelle mutiert: Laut ASTRA können die Bauarbeiten für den Tunnel, dessen Erstellungskosten mit 227 Millionen budgetiert sind, frühestens in vier Jahren starten – und dann weitere Jahre in Anspruch nehmen.
Ein No-go, gerade in der geschützten Reblandschaft von schweizweiter Bedeutung!
Bieler Tagblatt, 28. September 2023:
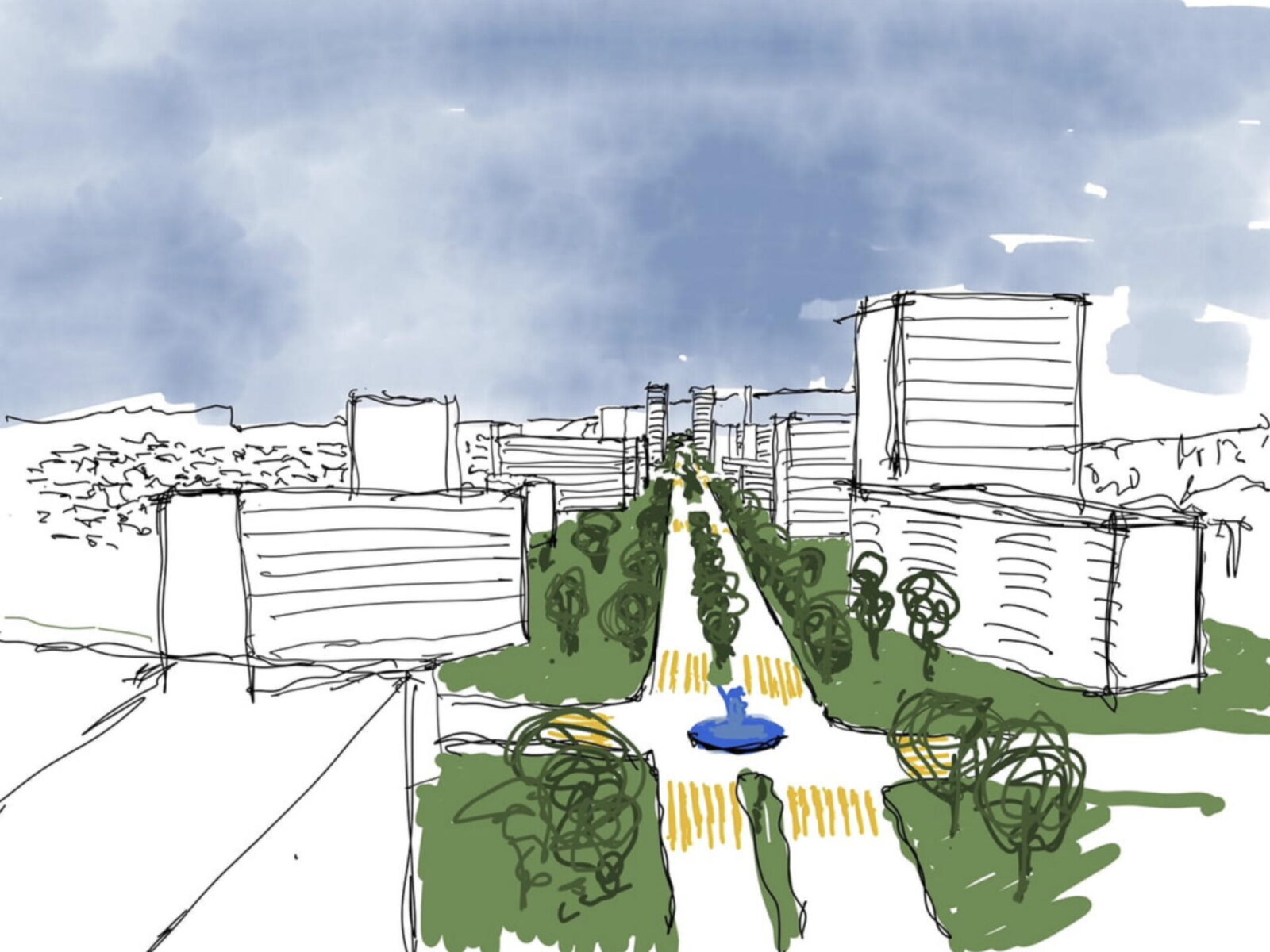
© Bilder: Stadtlabor Biel 2023
DIE POSSE GEHT WEITER
Seit über zwei Jahren ist er Geschichte. Aber das veraltete Strassendenken ist immer noch nicht vom Tisch… Nun schaffte es der Westast selig wieder einmal auf die Frontseite des Bieler Tagblatts. «Die Alternative zum Westast ist grün», titelt das Bieler Tagblatt vom 14. Juli 2023.
Schön wäre es. Doch grüngefärbte Skizzen mit leeren Strassen reichen nicht, um den motorisierten Verkehr zu reduzieren. Dafür bräuchte es handfeste Massnahmen.
Der Hintergrund für die Titelgeschichte im BT: Das Stadtlabor Biel hat ein «Zukunftsbild Weidteile» erarbeitet. Zur Erinnerung: Das Stadtlabor ist ein Folgeprojekt des Westast-Dialogs, das von damals Beteligten aus der Planer-und Architektenszene gegründet wurde und heute eine enge Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule BFH pflegt.
Involviert in die aktuelle Studie waren Studierende und verschiedene Fachverbände, letztere wieder vertreten durch ehemalige Delegierte im Dialoprozess. Folgerichtig haben sie denn auch das Zukunftsbild aus dem «Westastkompromiss» als Grundlage genommen, um die Zukunft des Weidteilequartiers in Nidau zu skizzieren.
Das Resultat: Schöne Worte, Grafiken und Visualisierungen, die eine grandiose Zukunft der als Problemquartier geltenden Weidteile auf Papier und Computerbildschirm zaubern. Die heutige sogenannte Stadtautobahn – in Tat und Wahrheit eine Strassenschneide, wo sich infolge von Lichtsignalanlagen und Barrieren während Stosszeiten immer mal wieder ein Rückstau bildet, soll zu einer «Stadtstrasse» werden. – «ein Paradigmenwechseln», titeln die Studienautor:innen.
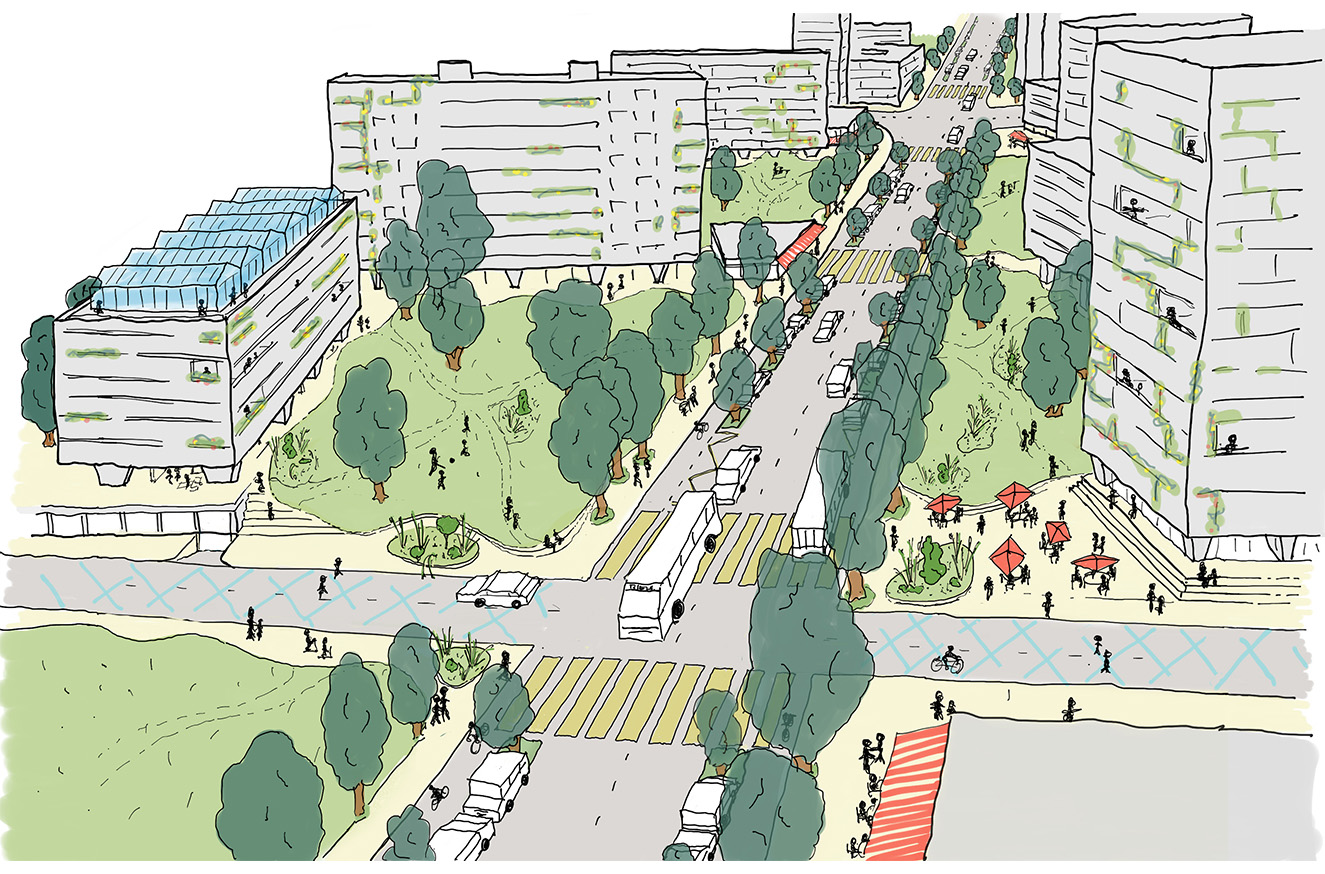
Was die Autor:innen der Studie als «Pradigmenwechsel» bezeichnen, ist nicht viel mehr als alter Wein in neuen Schläuchen. In früheren Publikationen wurde die Bernstrasse der Zukunft auch schon mal als «Boulevard» gepriesen. Die Neuauflage folgt dem alten Muster: Zwei Reihen von Bäumen, die eine Allee bilden, dazwischen separate Spuren für den Auto- und den Fuss- und Veloverkehr.
Mittels Temporeduktion und anderen lenkenden Massnahmen sollen die Zahl der heute rund 20’000 Fahrzeuge, welche die Bernstrasse täglich passieren, reduziert werden. Die Freiräume zwischen den Wohnblöcken will man «aufwerten», wodurch das Quartier als Ganzes lebendiger und lebenswerter werden soll.
«Die Umgestaltung bezweckt eine städtebauliche Aufwertung des Weidteilequartiers mit einer stark verbesserten Durchmischung der sozialen Schichten und Nutzungsvielfalt», heisst es etwa im Bericht des Stadtlabors. Die Rede ist zudem von einer «Reaktivierung der Erdgeschossnutzungen» und deren Umgestaltung für «publikumsorientierte Nutzungen.»
Was aber steckt dahinter? «Verbesserte Durchmischung» heisst im Falle der Weidteile nichts anderes als Gentrifizierung. Und was die vielzitierten lebendigen Erdgeschossnutzungen anbelangt, reicht ein Blick in die Innenstadt von Biel, um zu verstehen, dass dies nicht einmal an ausserodentlich idealen Passantenlage wie der Bahnhofstrasse oder Nidaugasse nicht mal klappt…
Trotzdem hätten es einige der Schlussfolgerung der Studie verdient, dass sich Behörden und Politiker:innen ernsthaft damit auseinandersetzen würden. Obschon die Neudefinition und Umgestaltung einer Strasse nicht reicht, um die Lebensqualität in einem Quartier zu verbessern, könnte damit immerhin ein Anfang gemacht werden. Viele der vorgeschlagenen Massnahmen wie etwa eine Temporeduktion auf der Bernstrasse oder die Schaffung von Fuss- und Velospuren könnten mit wenig Aufwand und zeitnah umgesetzt werden – bei entsprechendem politischem Willen.
Leider wissen wir: Das wird nicht geschehen. Weil Behörden und Politiker:innen das knappe Geld lieber für weitere Studien und Planspiele zum Fenster hinaus schmeissen, statt damit Massnahmen in die Tat umzusetzen, die erwiesenermassen Wirkung zeigen würden.
Fakt ist: Obschon die Ende Mai endlich veröffentlichten Verkehrszählungen eindeutig zeigen, dass das Verkehrsaufkommen in und um Biel nie und nimmer den Ausbau des Strassennetzes rechtfertigt, haben die Stadtparlamente von Nidau und Biel einen Kredit für eine «Gesamtmobilitätsstudie» durchgewinkt. Eine halbe Million Franken nimmt man in die Hand, um von Experten «den Nutzen von Jura- und Porttunnel» abklären zu lassen. Weitere 1,24 Millionen haben die Politiker:innen zudem für einen «Studienauftrag Achse Bernstrasse- Neuenburgstrasse» durchgewinkt.
Dies ist nichts anderes als Verschwendung von Steuergeldern. Gescheiter wäre es gewesen, Mittel zugunsten gezielter Sofortmassnahmen zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wird weiterhin Leerlauf produziert, der niemandem etwas nützt – ausser den beteiligten Ingenieur- und Planungsbüros. Da die Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau definitiv zum Abnick-Forum umfunktioniert worden ist, traut sich auch dort niemand mehr, solchen Leerlauf zu kritisieren.
ESPACE BIEL/BIENNE.NIDAU (EBBN)
VERANSTALTET EIN «FORUM»
Am 23. Mai 2023 ist es soweit: EBBN macht auf «Partizipation». Drei Stunden lang soll die Veranstaltung dauern, an welcher die Teilnehmenden über die Ergebnisse der Verkehrserhebungen vom letzten Herbst informiert werden sollen.
Während die IG Häb Sorg zur Stadt bekanntlich nicht mehr genehm ist – sie wurde nach zwei Jahren engagierter Mitarbeit in der Reflexionsgruppe rausgeschmissen – erhält das Forum nun handverlesenen Zuzug. Neu mit von der Partie sind das Bieler Stadtlabor sowie der Vingelz-Leist und das Komitee «N5 Bielersee so nicht».
Sie alle haben sich verpflichten müssen, sowohl die «Schliessung der Netzlücke» wie auch den Bau des Porttunnels zu unterstützen – dies war die unbedingte Voraussetzung für eine Teilnahme an den Forumsveranstaltungen. Mit dabei sind neu auch die Gemeindepräsident:innen der Gemeinden, die schon in der Behördendelegation vertreten sind.
Somit haben sich der Bieler Stadtpräsident und Leiter von EBBN Fehr & Co von vornherein eine zustimmende Mehrheit im Partizipationsinstrument «Forum» gesichert. Damit wird die von der Behördendelegation beschlossene Auftragserteilung für eine Gesamtmobilitätsstudie mit Fokus auf Port- und Juratunnel elegantdemokratisch durchgewunken. In China machen sie es genauso.
Bisher haben die Behörden Details zu den Ergebnissen der Verkehrserhebung zurückgehalten. Obschon die Auswertung längst vorliegt. Medial verbreitet wurde bisher einzig, dass die neuen Zahlen frühere Erhebungen bestätigen: 80 Prozent des motorisierten Strassenverkehrs in der Region sind «hausgemacht» – bloss 20 Prozent fallen in die Kategorie «Transitverkehr».
Es ist deshalb schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb nun mittels einer «Gesamtmobilitätsstudie» (Kostenpunkt: eine halbe Million CHF!) ausgerechnet neue Strassen wie der Jura- und der Porttunnel in den Fokus gerückt werden, die in erster Linie dem Transitverkehr dienen würden.
In der Einladungsmail fürs Forum bringt der Kommunikationsmann Hansjörg Ryser von EBBN die Absurdität des Unterfangens ungewollt auf den Punkt: «Thema des Abends sind die Ergebnisse der Verkehrserhebung vom vergangenen Herbst. Die Daten sind komplex und lassen je nach Betrachtungsweise unterschiedliche Schlüsse zu. Die Ergebnisse stellen jedoch eine reine Faktenbasis dar, welche in keiner Weise irgendwelche Interpretationen oder Richtungsentscheide durch EBBN impliziert.»
Mit anderen Worten: Bei EBBN kommt es auf die Betrachtungsweise der Messergebnisse an, die nicht wie gewünscht ausgefallen sind. Also betrachten und interpretieren die Autobahnpromotoren Fehr & Co. die vorliegenden Daten so, dass es zu ihren Zielen passt. Offensichtlich wollen sie sich von keinen Zahlen und Fakten vom eingeschlagenen Weg in Richtung Tunnel abbringen lassen.
MIT VOLLGAS IN DEN BERG
Die neueste Medienmitteilung von «Espace Biel/Bienne.Nidau» hätte auf Seiten der einstigen Westast-Gegnerschaft für einen Entrüstungssturm sorgen müssen – aber Windstille herrscht.
Zweieinhalb Jahre nach dem viel gefeierten «Westast-Kompromiss» geben die Autobahnpromotoren wieder den Tarif durch, knallhart: Obschon die längst versprochenen Verkehrserhebungen vom letzten Herbst erneut bestätigen, dass 80 Prozent des motorisierten Strassenverkehrs in Biel und Nidau «hausgemacht» sind, soll nun eine Studie in Auftrag gegeben werden, um «Nutzen und Zweckmässigkeit eines Port- und eines Juratunnels in einem nachhaltig funktionierenden Gesamtverkehrssystem» zu prüfen.
Das ist nicht nur ein Hohn, sondern nichts weniger als die dreiste Umkehr der Empfehlungen aus dem Dialogprozess. Diese forderten nämlich klipp und klar, dass in einem ersten Schritt kurz- und mittelfristige Massnahmen ergriffen werden, um die Verkehrssituation in der Region zu verbessern.
Das wurde bisher nur halbherzig an die Hand genommen, weder die Gemeinden noch der Kanton scheinen Willens oder in der Lage zu sein, konkrete Massnahmen zur Minderung des motorisierten Strassenverkehrs voranzutreiben.
Fakt ist, dass ein zeitgemässes «nachhaltig funktionierendes Gesamtverkehrssystem» ohne neue Tunnel- und Autobahnbauten funktionieren müsste. Entsprechend wäre die Fragestellung für das Design einer sinnvollen Gesamtmobilitätsstudie anzupassen.
Stattdessen soll nun für teures Geld nachgewiesen werden, dass es den Jura- und den Porttunnel braucht. Es ist davon auszugehen, dass der Auftrag an eines der immer gleichen Bureaus vergeben wird, die bereits in der Vergangenheit Gutachten produziert haben, die den Auftraggebern wohl gefallen haben.
Etwa mit der Studie, welche die Variante mit einer Seelandtangente vom Tisch gefegt hat. Nach diesem Muster wird die besagte «Gesamtmobilitätsstudie» die Notwendigkeit von Jura- und Porttunnel nachweisen – unter Geringschätzung aller Zahlen und Fakten, die dem widersprechen.
Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen: Die Stadträtinnen und ‑räte von Biel und Nidau können diese unsinnige Geldverschleuderung noch ablehnen. Die Kreditanträge an die Gemeinden für die Finanzierung der Studie sollen bereits Mitte Jahr vorliegen. Dies, weil die federführenden Stadtoberen die Studie raschmöglichst in Auftrag geben wollen.
Logisch: «Espace Biel/Bienne.Nidau» – die von den Autobahnbefürwortern gekaperte Organisation – wird 2025 aufgelöst. Also will man dafür sorgen, dass bis dahin eine «Gesamtmobilitätsstudie» nachweist, dass es ohne Jura- und Porttunnel nicht geht.
Mit Vollgas in den Berg – eine Rechnung, die niemals aufgehen wird. Weder Bund noch Kanton werden solch immense Infrastrukturprojekte für die «Lösung» hausgemachter Verkehrsprobleme künftig finanzieren. Zudem dürfte, falls sich das eine oder andere Projekt doch konkretisieren würde, der breite Widerstand gegen solchen Unsinn am Bielersee erneut aufflammen.
HALBZEIT – UND KEIN TOR IN SICHT
Am Donnerstagvormittag, 30. März 2023 hat Espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN), die Nachfolgeorganisation des Westast-Dialogs, zu einem «Mediengespräch» auf die Präsidialdirektion in Biel zu einem «Mediengespräch» eingeladen. Unter der Leitung von Stadtpräsident Erich Fehr und weiteren Vertreter:innen von EBBN gab es eine Standortbestimmung – unter dem Titel «Halbzeit bei espace Biel/Bienne.Nidau».
Vielleicht ist das die einzige News, die aufhorchen lässt: Bis anhin war nämlich niemals die Rede gewesen von einem zeitlich limitierten Rahmen von EBBN, der «übergeordneten Projektorganisation zur Koordination der verkehrlichen und städtebaulichen Planungsaktivitäten in der Region Biel».
Einzig im Anhang zum sogenannten Gesellschaftsvertrag der EBBN-Mitglieder steht, dass die Behördendelegation die Arbeitsschwerpunkt der Organisation «in einem ersten Schritt für den Zeitraum 2021–2025» festlegt.
Möglicherweise ist man allerdings, angesichts des bisher äusserst mageren Leistungsausweises von EBBN zum Schluss gekommen, dass auf den «ersten Schritt» kein zweiter folgen soll.
Was kein Verlust wäre: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Massnahmen aus dem Dialogprozess, die laut EBBN über das Agglomerationsprogramm der 4. Generation hätten umgesetzt werden sollen, vom Bund wegen mangelhafter Planung vorerst auf Eis gelegt wurden.
Trotzdem wurde anlässlich des Mediengesprächs erneut behauptet, ein Teil der im Schlusspapier des Dialogprozesses aufgeführten «kurz- und mittelfristigen Massnahmen» würden aktuell über ebendieses Agglomerationsprogramm umgesetzt.
Andere Massnahmen, wie etwa die Forderung nach einem Transitverbot für den Schwerverkehr durch die Stadt und entlang der Neuenburgstrasse, wurden bislang gar nicht erst in Angriff genommen. Laut Medienmitteillung von EBBN wird aktuell einzig als Minimalvariante geprüft, «die West-Ost-Achse und insbesondere die Reuchenettestrasse vom Schwerverkehr zu entlasten». Eine visionäre Umsetzung dieser Empfehlung sähe anders aus.
Immerhin hat man im Herbst 2022 endlich längst fällige Verkehrsmessungen in und um die Stadt Biel in Angriff genommen, deren Resultate nun in drei «übergeordnete Studien» einfliessen sollen.
Doch auch hier sind Zweifel angebracht: Werden Politik und Behörden bei der weiteren Planung die neuen Zahlen berücksichtigen? Gerade letzte Woche wurde bekannt, dass der Kanton Bern, obschon der Verkehr deutlich langsamer wächst als prognostiziert, an seinen Verkehrsprojekten festhält. Mit der lapidaren Begründung: «Diese müssen umgesetzt werden, weil die Infrastrukturen in den betroffenen Bereichen bereits heute überlastet sind und die prognostizierte Verkehrszunahme das Problem der fehlenden Kapazitäten weiter verschärft.»
Einmal mehr: Die zuständigen Politiker und Beamten haben aus dem Westastdebakel nichts gelernt. Während sich im Rest der Welt die Erkenntnis langsam durchsetzt, dass neue Strassen auch mehr Verkehr generieren und es bessere Lösungen gibt, ist man im Kanton Bern offenbar noch nicht soweit.
Hier träumen immer noch viele von einem Tunnel durch den Berg oder unter der Stadt Biel hindurch, zur sogenannten «Schliessung der Netzlücke». Weiterhin auf der Agenda von EBBN steht zudem der Bau eines Porttunnels – seit der Abschreibung des Westasts definitiv ein Absurdum. Trotzdem werden eifrig weiter Betonplanungen diskutiert und entsprechende Studien in Auftrag gegeben.
Neuerdings ertönen sogar aus Vingelz wieder Stimmen, die nach einem Tunnel schreien. Dies, weil weder EBBN noch die Stadt Biel oder das ASTRA bereit sind, die Pläne zur Erneuerung der A5 entlang des Bielersees gemeinsam mit der betroffenen Bevölkerung zu diskutieren und den Verkehr zeitgemäss zu gestalten, mit Rücksicht auf den Fuss- und Veloverkehr, die Umwelt und die Anwohner:innen.
Mittlerweile ist man bei den Kantons- und Gemeindebehörden längst wieder zurück in alten Fahrwassern: Dialog und eine gewisse Offenheit auf der Suche nach neuen Wegen in der Mobilitätspolitik, das war einmal. Weder die verantwortlichen Politiker:innen noch die tonangebenden Fachpersonen beim Kanton und in den Gemeinden scheinen auch nur das geringste Interesse an einer zeitgemässen Verkehrsplanung und ‑lenkung zu haben.
Zwei Jahre nach dem Start von EBBN als Nachfolgeorganisation des Runden Tischs lautet das ernüchternde Fazit: Ausser der Abschreibung des Westast-Projekts – ein grosser und wichtiger Erfolg! – hat der Dialogprozess nichts gebracht und nichts verändert. Im Gegenteil: Mit der Transformation der ursprünglichen Reflexionsgruppe zum EBBN-Forum, wo nur Autobahnplanungs-Abnicker:innen zugelassen sind, wurde auch die letzte Chance vertan, EBBN als Chance für die Umsetzung einer innovativen, betonarmen Mobilitätsentwicklung zu nutzen.
FRIEDE, FREUDE, EIERKUCHEN
Es klingt fast nach Euphorie, wenn man die Berichterstattung im Bieler Tagblatt über die «Informationsveranstaltung EBBN» vom Mittwoch, 15. März 2023 liest. Gemeinsam mit den in der Reflexionsgruppe verbliebenen und den zurückkehrenden Organisationen wurde diese zwar beerdigt, an ihrer Stelle dafür neu das EBBN-FORUM lanciert.
Zur Erinnerung: Im letzten Herbst hatten die ehemaligen Westast-Befürworter:innen sowie der VCS ihr Engagement in der Reflexionsgruppe sistiert. Die Behörden reagierten daraufhin mit einer Änderung der Spielregeln im laufenden Prozess und haben die IG Häb Sorg zur Stadt sowie die LQV-Vertreterin Beatrice Helbling aus der Reflexiongsgruppe ausgeschlossen.
Der Rausschmiss erfolgte ohne vorgängige Rücksprache mit den Betroffenen, bloss mit einer dürren Mail Anfang Februar. Das war und bleibt stillos: Weder die bisherigen Vorsitzenden der Reflexionsgruppe Erich Fehr und Sandra Hess noch der nun neu zum Leiter des EBBN-Forums ernannte «Mediator» Hansjörg Ryser hatten den Mut, ihre Beweggründe den beiden Organisatonsvertreterinnen persönlich zu erläutern.
Seis drum: Dank dem Rausschmiss, so war im Bieler Tagblatt nachzulesen, herrscht jetzt unter den verbliebenen Organisationen Friede, Freude, Eierkuchen. «Die Stimmung war gut», lässt sich Hansjörg Ryser im Bieler Tagblatt zitieren. Natürlich kann man sich fragen, wie lange das so bleibt. Angesichts der neuen Regeln, welche die Behörden für das Forum aufgestellt haben, dürfte es in Zukunft kaum mehr Raum zum Streiten geben.
Der neue Name des Gremiums ist nämlich gleichzeitig Programm: Es dient definitiv nicht mehr der Reflexion, sondern ist ein Forum für die Information ausgewählter Gruppen. Dabei soll die Teilnahme künftig auch Organisationen, die nicht am Runden Tisch des Westast-Dialogs teilgenommen hatten, offenstehen.
Das tönt gut und ist eine alte Forderung, die auch die IG Häb Sorg zur Stadt miteingebracht hatte. Allerdings müssen neu alle, die beim EBBN-Forum mitmachen wollen, sämtliche Punkte des Schlussberichts aus dem Westast-Dialogprozess voll und ganz mitttragen. Namentlich auch die absurde Forderung nach dem Bau eines Porttunnels sowie die aus der Zeit gefallene Planung für eine unterirdische Autobahn zur «Schliessung der Netzlücke».
So wird das Spektrum von Meinungen und Inputs, die von Seiten der teilnehmenden Organisationen einfliessen, von vornherein drastisch beschränkt. Doch zu grossen Diskussionen dürfte es eh nicht mehr kommen. Wie zu besten Stöckli-Zeiten, ist das EBBN-Forum in erster Linie eine Plattform für Behörden- und «Experten»- Happenings. Was diese unter «regelmässigem Informations- und Meinungsaustausch» verstehen, ist längst bekannt: Die eingeladenen Organisationsvertreter:innen dürfen abnicken. Das war schon in der Reflexionsgruppe nicht viel anders, doch nun ist der neue Name Programm.
Ein Déjà-vu für alle, die sich nicht erst seit gestern mit der Bieler Westast-Geschichte befassen. Sogar die Akteure sind noch die gleichen (zumindest zu einem grossen Teil…): Urs Scheuss für den VCS, Ivo Thalmann für den Heimatschutz, Alfred Steinmann für die Gruppe S, Denis Rossel für den LQV, Peter Bohnenblust für den TCS…
Wie einst in der «Arbeitsgruppe Stöckli», laufen insbesondere die ehemaligen Westast-Gegner:innen erneut Gefahr, dass sie als Statist:innen eine Fehlplanung mitbefördern, und als Feigenblatt behördlich beförderte Betonprojekte mitverantworten.
Statt, dass besagte Organisationen entschlossen auf eine zügige Umsetzung der smarten Empfehlungen aus dem Dialogprozess fokussieren und sich für eine innovative, klimagerechte und zukunftsfähige Mobilitätspolitik engagieren, lassen sie sich ins EBBN-Forum einbinden. Und unterstützen damit, dass weiterhin Hunderttausende Franken an Steuergeldern verschwendet werden, für eine «Partizipation», die keine ist sowie für die Planung von Strassenprojekten, die es nicht braucht – und die voraussichtlich nie gebaut werden.
ABRISS, LEERSTAND UND
EIN FUNKEN HOFFNUNG
Zum Schluss blieb nur noch ein Schutthaufen. Das Labiu ist endgültig Geschichte: Nach der Rettung vor dem Westast-Abriss kam schon bald das Ende: Statt Hand zu bieten für die dringend notwendige sanfte Sanierung, die eine Fortsetzung der alternativen Kultur und Lebensformen im Wydenauquartier ermöglicht hätte, schickten die Behörden die Bagger.
Zwanzig Jahre, nachdem eine Gruppe von Besetzer:innen ein alternatives Lebens- und Wohnexperiment anstelle von Parkplätzen erstritten hatte, konnte der Kanton nun doch noch seine ursprünglichen Pläne aus der Schublade ziehen: Auf der Parzelle, wo das Labiu stand, gibt es nun Parkplätze…
Sehr zur Enttäuschung der Verantwortlichen des angrenzenden Maschinenmuseums Müller: Als die Verantwortlichen der Firma vor rund 25 Jahren einen Standort für ihre exklusive Sammlung suchten, habe man ihnen von Seiten der Stadt in Aussicht gestellt, dass hier dereinst ein grüner Park für ein einladendes Ambiente sorgen soll. Daraus ist nie was geworden: Zuerst drohte auch dem Müller-Museum der Abriss, und nun kommt ein seelenloser Parkplatz.
Das Grundstück, wo bis vor kurzem das Labiu stand, gehört dem Kanton, genauso wie das angrenzende Bühler-Areal mit der wunderschönen, stattlichen Villa. Das Tiefbauamt hatte die Liegenschaften ursprünglich gekauft, um hier einen Installationsplatz für den Westast-Bau zu errichten. Letztes Jahr wurden die Grundstücke in den Etat der Bildungsdirektion überschrieben, als Baulandreserve für eine künftige Erweiterung des nahegelegenen Gymnasiums auf dem Strandboden.
Dafür gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne. Trotzdem steht die wunderschöne Villa seit Wochen leer – offenbar hat der Kanton kein Interesse, diesen kostbaren Wohnraum zu vermieten. Dem Vernehmen nach würde er die Villa wie das Labiu und die umliegenden Gewerbebauten am liebsten auch baldmöglichst dem Erdboden gleich machen. Aus Angst vor neuen Besetzer:innen…
Zu hoffen ist jedoch, dass es nie soweit kommt und man noch einmal über die Bücher geht: Die Bühler-Villa – ein Werk der bekannten Bieler Architekten Bernasconi von anno 1953 – ist nicht nur ein wunderschönes, sondern auch ein für die Stadt Biel identitätsstiftendes Gebäude und gehört unter Schutz gestellt, nicht abgerissen!
Dass es nämlich auch anders geht, zeigt die Baustelle in unmittelbarer Nähe: Die wegen der Westastblockade stark heruntergekommene Liegenschaft an der Aarbergstrasse 83 ist momentan eingerüstet und wird saniert! Und ab April können Mieter:innen hier in die frisch sanierten Wohnungen einziehen! Dieses Beispiel zeigt: Häb Sorg zur Stadt ist kein leerer Spruch, es geht, wenn der notwendige Wille da ist!
Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Stadt Biel mit ihrer neuerworbenen Liegenschaft an der Moserstrasse 2 ebenso sorgfältig umgehen wird wie die privaten Eigentümer der Liegenschaft an der Aarbergstrasse. Der Bieler Gemeinderat hat nämlich laut Medienmitteilung diese Woche einen Verpflichtungskredit von 905’000 Franken gesprochen, um das «Grundstück mit Einfamilienhaus» dem Astra abzukaufen. Die Parzelle, die zwar eine Bieler Adresse hat, aber auf Nidauer Boden liegt, dient der Stadt als «strategische Landreserve» – es ist also davon auszugehen, dass auch die Jahre dieses Hauses, das die Bedrohung durch den Westast überstanden hat, gezählt sind.
Auf der Brache vis-à-vis, wo die Westastpläne vor bald 20 Jahren einen abrupten Baustopp zur Folge hatte, wurde kürzlich wieder einmal gerodet. Ansonsten herrscht dort immer noch gähnende Leere. Offenbar sind sich die Stadt und der Grundeigentümer immer noch nicht einig geworden, wie hier die Stadt weiterzuentwickeln ist…
AUTOBAHNEN STATT
LEBENSQUALITÄT
Der Bundesrat hat im Februar 2023 über verschiedene Finanzierungsmassnahmen im Verkehrsbereich entschieden. Demnach sind für die Jahre 2024 bis 2027 allein für den Betrieb und Unterhalt des bestehenden Nationalstrassennetzes fast 9 Milliarden Franken budgetiert. Hinzu kommen fünf Ausbauprojekte mit Investitionskosten von über 4,3 Milliarden Franken.
Dazu gehören etwa die umstrittenen Projekte für eine Erweiterung der A1 im Grauholz auf acht Spuren, die dritte Röhre Rosenbergtunnel in St. Gallen oder der Rheintunnel in Basel. – Alles Betonprojekte, die in krassem Widerspruch stehen zu den Herausforderungen an eine klimagerechte Entwicklung der Mobilität.
Doch der Widerstand gegen diese teuren Mammutstrassenprojekte wächst. Nicht nur in der Region Bern haben sich Gemeinden, Parteien und Verbände zusammengetan, um den Betonwahnsinn am Grauholz zu stoppen – die Milliarden-Investitionen in den Strassenbau sind aus der Zeit gefallen und dürften von der Politik und der Bevölkerung nicht länger einfach durchgewinkt und goutiert werden.
Während in den Bau und Unterhalt der Autobahnen Milliarden fliessen, stellt der Bundesrat für die Agglomerationsprogramme 2024 bis 2028 gerade mal 168 Millionen Franken zur Verfügung. Dies, obschon die lokale und regionale Mobilität ein Schlüsselfaktor ist, wenn es darum geht, den Verkehr in unserem Land umwelt- und klimaverträglicher zu gestalten.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass Projekte, welche die Aufenthaltsqualität und Sicherheit für den Fuss- und Veloverkehr ins Zentrum stellen, wie etwa die Neugestaltung des Unteren Quai in Biel oder die Umgestaltung des Bären- und Waisenhausplatzes in Bern, vorerst keine Bundesgelder erhalten.
Damit bewegt sich der Bundesrat leider (noch) auf der gleichen Linie wie das ASTRA oder Espace Biel/Bienne.Nidau, wo ebenfalls immer noch in erster Linie vom Steuerrad her gedacht und geplant wird. Etwa, wenn es um die «Sanierung» der Neuenburgstrasse geht, oder um die immer noch im Raum stehende «Schliessung der Netzlücke» in Biel.
Mit dem vorliegenden Bundesratsentscheid zum Agglomerationsprogramm der 4. Generation wird in Bezug auf die im Rahmen des Westast-Dialogprozesses geforderten kurz- und mittelfristigen Massnahmen für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Region Biel einmal mehr klar: Die von den Behörden vorgeschobene Umsetzung eines Teils der Massnahmen über dieses Programm, ist und bleibt eine Farce.
Wo bleiben, über zwei Jahre nach der Verabschiedung des Massnahmenkatalogs, konkrete Pläne zu deren Umsetzung? Mit einem Flüsterbelag auf der Bernstrasse und einem Projekt für die Querung der A6 in Brügg ist es nicht getan. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse, das man nach der Abschreibung des Westastprojekts offenbar im letzten Moment noch ins Agglomerationsprogramm integriert hatte, wurde vom Bund mit dem Prädikat «Planungsstand ungenügend» ebenfalls abgeschmettert…
EBBN AUF DEM HOLZWEG
Der Rausschmiss der IG Häb Sorg zur Stadt aus der Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau EBBN ist ein deutliches Signal: Fortan soll es in diesem Gremium noch weniger Platz geben für Diskussionen und Bestrebungen hin zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Mobilität.
Der Ausschluss jener, die das Weiterplanen an teuren, unnötigen und wohl nie realisierbaren Autobahnprojekten und Strassentunnel für sinnlose Geldverschwendung halten, zeigt: Die Behörden und die grossen Verbände in der Region Biel wollen nicht – wider besseres Wissen – nur an der Option Autobahnausbau festhalten. Sie wollen diese auch noch beschleunigen…
EBBN befolgt ohne Wenn und Aber die Forderungen der Autobahn- und Wirtschaftslobby, und «opfert» dafür kritische, innovative und zukunftsorientierte Stimmen. Fortan dürfte in der «Reflexionsgruppe» noch weniger reflektiert werden als bisher…
Nachdem der Westast-Dialog vor zwei Jahren schweizweit als grosser Erfolg gefeiert wurde, droht nun der ultimative Rückfall ins Autobahnbau-Zeitalter. Die amputierte Reflexionsgruppe ist nur ein Zeichen dafür, dass die Behörden und manche Politiker:innen aus der Westastbewegung offenbar nichts gelernt haben.
Gleichzeitig publizierte das Bieler Tagblatt am 10. Februar ein aufschlussreiches Gespräch mit dem Umweltjournalisten Marcel Hänggi, der klipp und klar festhält: «Leider geht es gerade im Verkehrsbereich immer noch in die falsche Richtung. Sei es in Biel oder andernorts. Man geht nach der Logik: Da hat es viel Verkehr, also müssen wir mehr Strassen bauen. Dabei weiss man, dass jede neue Strasse zusätzlichen Verkehr generiert.»
Biel sei diesbezüglich momentan gut dran, weil man den Westast gestoppt habe, fährt Hänggi fort. Nun gehe es aber darum, das Richtige zu tun: «Als Nächstes kann man Verkehrswege wieder verlangsamen. Eine Stadt sollte sich an der Geschwindigkeit des Gehens orientieren. Im Prinzip ist es eine Rückeroberung: Der öffentliche Raum ist mehr als nur eine Fahrbahn, er sollte ein Lebensraum sein.»
 Mit Hess und Fehr gibts mehr Verk…
Mit Hess und Fehr gibts mehr Verk…
Leider haben die Verantwortlichen von EBBN dies immer noch nicht begriffen. Der Ausschluss der IG Häb Sorg zur Stadt, die sich stets für eine Fokussierung auf nachhaltige Mobilitätslösungen und damit für eine Beförderung der Lebensqualität in der Stadt und Region engagiert hat, verheisst nichts gutes.
RAUSSCHMISS!
Am Donnerstagmorgen, 9. Februar 2023, erhielt die IG Häb Sorg zur Stadt vom Sekretariat Espaces Biel/Bienne.Nidau dicke Post: In dürren Worten liess man uns per Mail wissen, dass wir aus der Reflexionsgruppe rausgeschmissen werden.
Laut der Mitteilung habe sich «nach zahlreichen Gesprächen» herausgestellt, dass die Anerkennung des Schlussberichts aus dem Dialogprozess neu Voraussetzung sein soll, um weiterhin in der Reflexionsgruppe mitzuwirken. Dies, nachdem wir uns während mehr als zwei Jahren engagiert in die Debatte um zukunftsfähige, gute Lösungen für die Mobilität in unserer Region eingesetzt haben.
Der einzige, der stets lautstark an der Forderung festgehalten hatte, das nur mitdiskutieren dürfe, wer den «Westast-Kompromiss» unterschrieben habe, war Gilbert Hürsch, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Biel-Seeland und im Dialogprozess Vertreter der Westastbefürworter:innen. Schon damals war sein bevorzugtes «Argument» die Drohung mit dem Abbruch des Dialogs gewesen. Im letzten Herbst dann hatten er und seine Mitstreiter:innen beschlossen, sich aus der Reflexionsgruppe zu verabschieden…
Fakt ist: Die IG Häb Sorg zur Stadt hatte im Dezember 2020 das Schlussdokument aus dem Dialogprozess nicht unterzeichnet, weil wir der Überzeugung sind, dass der Fokus jetzt und in naher Zukunft auf die Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Massnahmen sowie innovativen Mobilitätskonzepten liegen müsse, die eine sogenannte «Langfristlösung» in Form einer Autobahn überflüssig machen. Aus den gleichen Gründen verweigerten wir auch der weiteren Planung am Porttunnel die Unterstützung.
In der Reflexionsgruppe hatte die IG Häb Sorg zur Stadt das klare Commitment, dass wir uns weder zum Porttunnel noch zur Autobahn-Variantendiskussion äussern würden, woran wir uns auch gehalten haben. Es gab und gibt mehr als genug wichtige und vielversprechende Massnahmen zu debattieren, so dass uns das auch nie schwergefallen ist. Im Gegenteil: Wir sind der Überzeugung, dass unsere Ideen und Visionen ein wichtiger Input für die Mobilitäts-Entwicklung in unserer waren – und es auch in Zukunft bleiben.
Fakt ist auch, dass noch an der letzten Sitzung im November 2022, als die in der Reflexionsgruppe verbliebenen Organisationen zusammen mit Behördenvertreter:innen ein äusserst konstruktives Treffen hatten, die Vertreterin des Tiefbauamts klarstellte, dass eine Wiederaufnahme des Autobahnprojekts beim Kanton in den nächsten Jahren kein Thema sei.
Trotzdem ist Hürsch mit seiner Forderung nun durchgekommen – vermutlich mit Unterstützung der anderen ehemaligen Westastbefürworter sowie des VCS, die im letzten Herbst ihre Mitarbeit in der Reflexionsgruppe sistiert hatten. Espace Biel/Bienne.Nidau, unter der Leitung von Erich Fehr und Sandra Hess, ist eingeknickt und hat uns rausgeschmissen.
Anlässlich der letzten Reflexionsgruppensitzung hatte man in Aussicht gestellt, nach einer Lösung für die Zukunft dieses Gremiums zu suchen und diese erst nach aussen zu tragen, «wenn alle einverstanden sind.» Ob wir mit dem Rausschmiss einverstanden sind? – Wir wurden nicht danach gefragt..
Nun wissen wir aber bereits heute, was Sache ist. Nebst der IG hat man auch Beatrice Helbling, die als Vertreterin des LQV in der Dialoggruppe aus den gleichen Gründen wie die IG im Dezember 2020 das Schlussdokument nicht unterschrieben hatte, aus der Reflexionsgruppe rausgeschmissen.
Keine Sorge: Wir bleiben dran! Jetzt erst recht!
Die Reflexionsgruppe mutiert mit unserem Rausschmiss endgültig zu einer ärgerlichen Alibiübung, mit der bloss Steuergelder verbraten werden. Umso motivierter sind wir, in Zukunft unser Engagement für Lebensqualität und eine menschenfreundliche Mobilität wieder auf die Strassen und Plätze zu tragen…
Bieler Tagblatt, 10. Februar 2023:
PRO WESTAST + CO
IM VERWEIGERUNGSMODUS
Heute Vormittag hat eine Pressemitteilung der ehemaligen Pro-Westastfraktion aus dem Dialogprozess für einen Sturm im Wasserglas gesorgt: In einer gemeinsamen Verlautbarung erklären die Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS), der Handels und Industrieverein des Kantons Bern, die Bieler Sektion der Berner KMU, das Komitee Pro-Westast sowie der TCS Biel-Seeland, dass sie ihre Teilnahme in der Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau sistieren würden.
Eine Trotzreaktion, die nicht ganz unerwartet kam: Bereits an den letzten Treffen der Reflexionsgruppe waren die oben genannten Organisationen immer wieder nur spärlich vertreten. An der letzten Sitzung vom 26. August nahm gerade einmal ein einziger Vertreter der Wirtschaftslobby teil. Statt mit Argumenten zur Diskussion beizutragen, ist er bereits kurz nach Beginn des Treffens rausgelaufen…
Mit ihrer «Sistierung» zementieren die ehemaligen Pro-Westastorganisationen ihre Verweigerungshaltung bei der Suche nach zukunftsfähigen, angepassten Lösungen. Damit beweisen sie einmal mehr: Die Wirtschaftsverbände wollen auf Teufel komm raus die Schliessung der sogenannten «Netzlücke». Dies, obschon gerade die umstrittene Studie zur Seelandtangente einmal mehr zeigt, dass der Bau einer weiteren Autobahnstrecke unnötig und keine Lösung ist…
Die Wirtschaftsverbände sind nicht bereit, die Umsetzung und Wirkung der zahlreichen im Dialogprozess beschlossenen kurz- und mittelfristigen Massnahmen abzuwarten. Obschon das Schlusspaper des Runden Tischs dies eindeutig verlangt: Im Vordergrund steht nicht die sofortige Planung einer neuen «Autobahn-Lösung», sondern die Umsetzung von zahlreichen Massnahmen für den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr. Erst wenn diese nicht die erhoffte Wirkung zeigen sollten, wäre in einem nächsten Schritt als sogenannt «langfristige Lösung» die Planung einer Autobahn wieder auf dem Tisch.
VERNICHTENDE KRITIK
Der international renommierte Verkehrsplaner Helmut Mario Reiter, der selber in Biel lebt und die Verhältnisse kennt, redet im Bieler Tagblatt Klartext zur Studie zur Seelandtangente. Seine Bemerkung betreffend Verkehrsplanung und ‑entwicklung sollten sich die Behörden besonders zu Herzen nehmen: «Aber vielleicht müsste man künftig die Reihenfolge umdrehen: Weil man so viel Platz sparen kann und die CO2-Bilanz so viel besser ist, müsste man zuerst fürs Velo planen und in einem zweiten Schritt schauen, was man fürs Auto machen kann.»
AUF DEN PUNKT GEBRACHT!
Der Wochenkommentar von Jérôme Léchot vom Samstag, 3 September 2022 im Bieler Tagblatt bringt es auf den Punkt: Anhand der Seelandtangente zeigt er auf, dass das Zeitalter des Autobahnbaus endgültig vorbei ist! Die Schlussfolgerungen aus der Studie zur Seelandtangente können nämlich 1:1 für alle weiteren Autobahnvarianten übernommen werden… Für alle gilt:
«2050 schon muss die Schweiz ihre CO2-Bilanz auf Netto-Null heruntergebracht haben. Auch wenn man die Fahrzuegflotte elektrifiziert und genug Strom dafür haben sollte – es ist energetisch nicht wahnsinnig effizient, zwei Tonnen Fahrzeug für 0.14 Tonnen Passagiere mit hoher Geschwindigkeit durch den Luftwiderstand zu pressen. Es wird uns hoffentlich etwas Klügeres einfallen, um von A nach B zu gelangen. Dann wäre eine solche Autobahn aus der Zeit gefallen, bevor sie überhaupt hat fertiggestellt werden können.»
SEELANDTANGENTE DEFINITIV VOM TISCH
Das Resultat der Studie, die im Frühling 2022 auf Druck der Reflexionsgruppe in Sachen Seelandtangente in Auftrag gegeben wurde, hat nun erwartungsgemäss das von den Behörden erwünschte Resultat gebracht: Eine Verlegung der N5 vom linken aufs rechte Bielerseeufer sei weder zweckmässig noch bewilligungsfähig, lautet das Fazit.
Nach langer Geheimniskrämerei – die Studie lag bereits vor den Sommerferien vor, wurde aber bis Ende August unter Verschluss gehalten – hat die Behördendelegation an ihrer Sitzung vom 30. August die Seelandtangente ein weiteres Mal und diesmal wohl für immer bachab geschickt.
Aus guten Gründen, wie die Lektüre der Studie zeigt. Im Zentrum stehen dabei Modellberechnungen, wonach eine Seelandtangente (untersucht wurden drei verschiedene Varianten) gerade mal von 6000 bis maximal 9000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert würde. Zuwenig, um den Bau einer Nationalstrasse mit massiven Eingriffen in Natur und Landwirtschaft, zu rechtfertigen.
Die neue Strasse würde, so die Studie, den Siedlungsdruck im Seeland erhöhen, nur punktuelle Entlastungen bringen und gleichzeitig zusätzlichen Verkehr generieren. Zudem hätte sie massive Auswirkungen auf die Fruchtfolgeflächen. In der Medienmitteilung von Espace Biel/Bienne.Nidau steht gar, dass allfällige Bodenverbesserungen durch die Nutzung von Aushubmaterial, wie dies der Raumplaner Kurt Rohner schon vor Jahren angeregt hatte, «den Verlust an solchen Flächen nicht kompensieren» würden.
Fakt ist allerdings, dass diese innovative und bestechende Idee gar nie untersucht wurde: Wie Studienautor Christian Berger der Firma Transitec anlässlich der mündlichen Präsentation am Freitag, 26. August vor der Reflexionsgruppe ausführte, wurden für die Studie weder Boden- noch Landwirtschaftsfachleute beigezogen.
Wie auch immer: Mit den nun vorliegenden Abklärungen zur Seelandtangente ist nun die erste Variante für eine «langfristige Autobahnlösung» vom Tisch. Das ist gut so. Denn wer weiterdenkt kommt mit etwas gesundem Menschenverstand zum Schluss: Auch die anderen beiden zur Diskussion stehenden Autobahnvarianten (Juratunnel und «Westast-so-besser») werden einer Prüfung, wie sie jetzt für die Seelandtangente erfolgt ist, ebenfalls nicht standhalten.
Genau zu diesem Schluss kommt auch Stefan von Bergen in der Berner Zeitung: «Schon jetzt lässt sich vermuten, dass auch über die anderen Strecken der überregionale Verkehr von Solothurn in die Romandie kaum die Zahl von 6000 Fahrzeugen im Tag übersteigen würde. Auch bei einem notabene teuren Juratunnel wäre also das nationale Interesse kaum gegeben. Ohne dieses aber wird kein Geld aus der Bundeskasse fliessen.»
Berner Zeitung:
Bieler Tagblatt:
Vollständige Berichterstattung: click and read
PR OHNE ENDE
Die Journalistin Carmen Stalder hat es im Bieler Tagblatt auf den Punkt gebracht: «Pseudo- Partizipation bringt niemandem etwas» lautet der Titel ihres Wochenkommentars, in dem sie sich kritisch mit der «Partizipations-Offensive» auseinandersetzt, mit der die Bieler Behörden aktuell versuchen, die Bewohner:innen ihrer Stadt zu bezirzen.
Gleichzeitig bietet das BT allerdings auch gratis eine Plattform für diese städtische PR-Aktion: Pünktlich, am Wochenende vor der wichtigen Abstimmung im Stadtrat über den Kredit für die x‑te Partizipation in der Seelandmetropole, publizierte die Lokalzeitung ein doppelseitiges Interview mit Paul Krummenacher. Der einschlägig bekannte und erfahrene Dompteur in Partizipationszirkussen, soll die gross angekündigte Bürger:innenbeteiligung bei der Umgestaltung des Bahnhofplatzes und seiner engsten Umgebung erfolgreich managen.
Weil sich Gemeinderäte allerorten vor nichts mehr fürchten, als einer Bevölkerung, die ihnen dauernd dreinredet, liegt es im Trend von oben offensiv das Heft in die Hand zu nehmen und laut zu rufen: Partizipation, Partizipation, professionell gemanagte Partizipation! Das Geld liegt dafür offenbar zur Genüge in der Stadtkasse. Sogar in Biel…
Kurzum: Es ist zu befürchten, dass das Bieler Stadtparlament am kommenden Donnerstag den Kredit zur Ausarbeitung des Nutzungskonzepts Bahnhofgebiet in der Höhe von CHF 927’000 durchwinken wird.
Zu wünschen wäre allerdings, dass dies nicht ohne Antrag auf Nachbesserung geschieht: Dies, weil der Perimeter des künftigen Nutzungskonzepts ausgerechnet jene Areale, die besonderes Entwicklungspotenzial aufweisen, explizit (und bewusst) ausklammert:
Das Wydenauquartier, das infolge der jahrzehntelangen Westast-Fehlplanung am Verfallen ist, birgt enorme Möglichkeiten. Es ist zu vermuten, dass dort unter der Hand Einiges am Tun ist – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne die für die Planer lästigen Partizipationsprozesse.
Genauso, wie dies aktuell beim Schönegg-Areal geschieht, das – ebenfalls als Folge der Westast-Fehlplanung – seit Jahren erzwungenermassen brach liegt. Dessen Eigentümer würde gerne vorwärts machen und seine Pläne umsetzen. Da sich das Areal jedoch in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) befindet, will die Stadt bei der Entwicklung ein gewichtiges Wort mitreden – und scheint dafür sehr konkrete Vorstellungen zu haben, die sich in zentralen Punkten von jenen des Eigentümers unterscheiden.
Welche Entwicklung sich die Bevölkerung wünscht oder vorstellen könnte, steht hingegen nicht zur Debatte. Obschon es sich hier um eine Liegenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof handelt, deren Entwicklung eigentlich zwingend mit jener des Bahnhof- sowie des Schlachthofareals geplant werden müsste.
Kurzum: Es ist unbestritten, dass die Bevölkerung bei der Entwicklung ihrer Stadt rund um den Bahnhof mitreden soll. Paul Krummenacher und sein Team mit ihrer grossen Erfahrung sind dafür die richtigen Partner. Das Ganze macht aber im vorliegenden Fall nur Sinn, wenn der Perimeter des Nutzungskonzepts erweitert und die Stadtentwicklung in diesem Gebiet ganzheitlicher angegangen wird.
Die Stadt Biel hat aktuell die Chance, wichtige Weichen zu stellen. Dies geschieht allerdings nicht, indem man der Bevölkerung mit von oben zielgerichtet gesteuerter Partizipation Light einlädt, wie dies aktuell im Rahmen von CityLab und Particibienne geschieht.
Die gross aufgezogene PR-Übung zur kurzfristigen Schönung der «Innenstadt» – deren Perimeter mit Absicht auf die Achse Bahnhof-Mühlebrücke beschränkt wurde – dürfte nicht einmal ein Mäuslein gebären: Von den 88 vorgeschlagenen Projekten, hat ein unbekanntes Gremium deren 65 bereits in den Papierkorb entsorgt. Abgestimmt werden kann ausschliesslich über kosmetische Interventionen in der Stadt, die schnell, billig und mit Vorzeigeeffekt zu realisieren sind.
Dazu gehören etwa die temporäre Verlängerung des Betriebs auf sommerlichen Restaurant-Terrassen oder das Aufstellen von bunten Sitzbänken, die von Vereinen und Geschäften gesponsert werden (notabene beides Vorschläge, eingebracht von den Event- und PR-Büros, die bereits Citylab gegen gängiges PR-Honorar umsetzen…).
Abgelehnt und damit ausgeschieden wurden hingegen ernsthafte Inputs der Bevölkerung wie etwa der Wunsch nach einer autofreien Altstadt, die Förderung von Urban Gardening auf Flachdächern, die Begrünung der Esplanade oder die Unterstützung des Kultur- und Begegnungszentrums auf dem Schlachthofareal…
Particibienne ist ein Lehrstück dafür, wie Pseudo-Partizipation viel Geld und Ressourcen verschlingt, aber wenig bewirkt. Der Kreis derjenigen, die sich beim Sammeln der Ideen beteiligt haben, blieb denn auch sehr beschränkt. Das Ergebnis ist mager, die farbenprächtigen Sitzbänke werden aber ins Auge fallen und darüber hinwegtäuschen. Was die von der Stadt angeheuerten Event- und PR-Büros als Anlass nehmen werden, um ein buntes Loblied auf das Resultat der von ihnen selber eingebrachten «Partizipations-Ideen» anzustimmen.
ÜBERALL DER GLEICHE BLÖDSINN:
ERFINDE EINE AUTOBAHNLÜCKE UND SCHLIESSE SIE!
 Bilder © wikicommons, Leonhard Lenz, 2021 – Fahrraddemo Treptow
Bilder © wikicommons, Leonhard Lenz, 2021 – Fahrraddemo Treptow
In Berlin leistet die Bevölkerung seit Jahren Widerstand gegen die Stadtautobahn A100. Die Stadtregierung hat sich denn auch deutsch und deutlich gegen den Bau eines weiteren Teilstücks dieses Beton-Monsterprojekts ausgesprochen. Trotzdem hat die staatliche Autobahn GmbH (das deutsche ASTRA) nun den Auftrag zur Planung des 17. Bauabschnitts ausgeschrieben, wie im «Spiegel» vom 29. März 2022 nachzulesen ist. Kosten: über 500 Millionen Euro.
Die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch bezeichnet das Projekt als «Verkehrspolitik von vorgestern» und ihr Parteikollege, der Grüne Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar stellt klar: Diese Planung ist reine Geldverschwendung. Wenn die A100 tatsächlich gebaut würde, «zerstört sie die Stadt und frisst wertvolle Flächen.»
Der Alleingang der staatlichen Autobahnbaufirma verstösst eigentlich auch gegen den «neuen Infrastrukturkonsens» der deutschen Regierung von SPD, Grünen und FDP, der besagt: Wenn schon Investitionen in Autobahnen, dann Reparatur statt Neubau. Leider gibt es aber in dieser Vereinbarung – der «Bieler Westastkompromiss» lässt grüssen – ein unseliges Bekenntnis zu «Lückenschlüssen» – wozu auch die A100 gehöre, so Daniela Kluckert (FDP), Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, deren Chef Verkehrsminister Wissing (FDP) ein bekennender Autoverkehrsminister ist.
Weitere Parallelen zur Bieler Autobahngeschichte: Der 17. Bauabschnitt soll über die Spree führen sowie in einem doppelstöckigen Tunnel unter dem dicht besiedelten Wohngebiet in Friedrichshain hindurchführen und mit zwei innerstädtischen Ausfahrten das Ostkreuz und die Frankfurter Allee anschliessen.
Ein Albtraum, den die staatlichen Autobahnturbos auf Teufel komm raus offenbar durchdrücken wollen.
Dabei zeigt die Stadt Berlin, dass es in Sachen Autoverkehr auch ganz anders geht. Wo es in der Kompetenz der Stadt liegt, ist eine Verkehrwende im Gang. Im August 2020 wurde zum Beispiel die berühmte Friedrichstrasse auf einem halben Kilometer Länge für Autos gesperrt und zur «Flaniermeile» erklärt. Für Velofahrende gibt nun es eine eigene Spur mit einem Tempolimit von 20km/h. Auf frei gewordenen Flächen wurden Holzbänke aufgestellt, Ladenbesitzer machen dort in Vitrinen auf ihre Angebote aufmerksam… Neuste Zahlen zeigen: Das Projekt ist ein voller Erfolg! – Die Zahl der Menschen, die sich in der Friedrichsstrasse zwischen der Französischen und der Leipzigerstrasse aufhalten, hat sich gegenüber der Zeit, als Autos hier noch rumkurvten, um 65 Prozent erhöht!
Das Interview zum Thema im Tagesspiegel vom 18. April 2022:
Die Argumentationslinien kennen wir bestens! – Es ist immer wieder das gleiche Lied, egal ob in Berlin oder Biel…
VERWIRRSPIEL
UM DEN JURATUNNEL
Brisante Titelgeschichte in der gestrigen Berner Zeitung BZ: «Kanton hortet Land für möglichen Autobahnanschluss» lautete der Titel einer Recherche von Simone Lippuner, die aufzeigt, dass der Kanton Bern eine Reihe der Liegenschaften, die er im Hinblick auf den Bau des Westasts gekauft hatte, in seinem Portfolio behält.
Während letzte Woche bekannt wurde, dass die Parzelle am Wydenauweg 40, wo das Grosswohngemeinschaft «Labiu» zuhause ist, dem Kanton als Reserve für die Erweiterung des Gymnasiums diene, lässt Kantonsoberingenieur Stefan Studer in der BZ verlauten, für die Planung der Nationalstrasse würden aktuell «von den 19 noch 10 Parzellen zurückbehalten, die für einen allfälligen späteren Bau des Porttunnels oder für einen Juratunnel benötigt würden.»
Der Juratunnel, so Studer unmissverständlich weiter, stehe für die Behörden im Vordergrund – der Start einer entsprechenden Studie sei für 2023 geplant… Dies, obschon bis heute – entgegen der Empfehlungen aus dem Dialogprozess – kurz- und mittelfristige Massnahmen zur Verkehrsberuhigung noch kaum umgesetzt worden sind und man deshalb deren Wirkung noch gar noch nicht abschätzen.
Trotzdem wird die Planung eines Juratunnels mit Priorität vorangetrieben. Im Februar 2022 hatte Regierungsrat Christoph Neuhaus dies gegenüber der WoZ ebenfalls bestätigt und darüber hinaus erklärt, dass die sogenannte «Schliessung der Autobahn-Netzlücke in Biel» vom Bund nur mitfinanziert würde, wenn es auch «zusätzliche Anschlüsse» gebe.
Davon will er heute nichts mehr wissen, nachdem ihm der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr via Bieler Tagblatt öffentlich vorgeworfen hatte, «mit solchen Aussagen den Brunnenvergifter zu spielen». Auf Nachfrage von BT-Chefredaktor Lino Schären gibt sich der letzten Sonntag mit einem miserablen Resultat wiedergewählte Baudirektor nun ungewohnt wortkarg und krebst im heutigen Bieler Tagblatt zurück: «Diese Aussage ist hinfällig.»
Es scheint, als ob gewisse Behörden beschlossen hätten, den Begriff «Juratunnel» vorläufig aus ihrem Vokabular zu streichen – um die Gemüter zu beruhigen. Die Aussagen von Kantonsoberingenieur Studer machen hingegen deutlich, dass man in den kantonalen Berner Amtsstuben weiterhin mit Volldampf auf eine «Autobahnlösung» hinarbeitet.
Indizien dafür sind nicht nur die vom Kanton zurückbehaltenen Parzellen in der Seevorstadt. Hinzu kommt, dass das ASTRA die Verkehrskapazitäten auf der Neuenburgstrasse weiter erhöhen will und mit seiner aktuellen Planung den Weg für einen Anschluss an einen Juratunnel ebnet.
Auch wenn der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr versucht, die Wogen zu glätten und die Behörden von einem «unterirdischen und stadtverträglichen Anschluss» schwurbeln – ein Autobahnanschluss bleibt ein Autobahnanschluss. Dieser ist aber im Siedlungsgebiet, laut den Empfehlungen aus dem Dialogprozess abzulehnen. Dies gilt definitiv auch für die Bieler Seevorstadt.
Kommt hinzu: Solange der Kanton und die Stadt im Hinblick auf künftige Autobahnanschlüsse Parzellen in der Seevorstadt zurückbehalten , verlängern sie die jahrelange Planungsunsicherheit und ‑blockade für die privaten Liegenschaftsbesitzer. Das heisst: Weiterhin Verfall von Gebäuden und Innovationsrückstau statt Aufbruch und Aufschwung.
Mit anderen Worten: Die rundum schädliche Blockade, die man mit der Abschreibung des Westast überwunden glaubte, bleibt weiterhin bestehen – statt des erhofften Auswegs, steuert der Dialogprozess aktuell direkt in die nächste verheerende Autobahnplanungsspirale.
ZAGHAFTE SCHRITTE – IMMERHIN IN DIE RICHTIGE RICHTUNG…
Der Schüssquai zwischen Zentralplatz und Spitalstrasse soll grüner und lauschiger werden… Die Bieler Baudirektorin Lena Frank und Stadtpräsident Erich Fehr präsentierten gestern das Siegerprojekt des Wettbewerbs, der letztes Jahr für die Umgestaltung der Schüsspromenade ausgeschrieben worden war.
Gewonnen hat das Genfer Büro apaar mit dem Projekt «Canal éponge» – weil es laut Jurybericht den Unteren Quai in diesem Teilabschnitt überzeugend in einen «belebten und klimafreundlichen öffentlichen Raum» verwandeln will. Mit vielen Pflanzen, Mikrospots zum Verweilen und mehr Raum für Fuss- und Veloverkehr.
Ein guter Schritt in die richtige Richtung – allerdings allzu zaghaft. Die Pläne und Visualisierungen des Siegerprojekts zeigen zwar eine einladende Promenade entlang der Schüss, ohne Autos. Dies entspricht aber leider nicht der Realität, wie sie aktuell geplant ist. «Verschwinden werden die Autos nicht, viel eher wird auf der Strasse, ähnlich wie die Begegnungszone auf dem Zentralplatz, ein Nebeneinander von verschiedenen Verkehrsteilnehmern herrschen», beschreibt das Bieler Tagblatt den aktuellen Stand der Planung. Entlang der Schüss sollen laut der Bieler Stadtplanerin gerade mal 10 Parkplätze aufgehoben werden – und auch das sei noch nicht in Stein gemeisselt.
«Weg mit den Autos!» fordert demgegenüber die BT-Journalistin Deborah Balmer in ihrem Kommentar. Recht hat sie, zumal sich dieser Abschnitt mitten in der Stadt bestens eignet für eine reine Fuss- und Veloflanierzone. «Erfreulich, dass viel Grün den Aufenthalt dort viel angenehmer machen wird. Doch bitte, liebe Stadt Biel, habe genug Mut für einen autofreien Strassenabschnitt», fordert Balmer und bringt es auf den Punkt: «Grosse Städte in Europa machen es vor: die moderne Innenstadt ist autofrei. Wenn schon, denn schon. Von einer linksgrün regierten Stadt erwarten die Wähler nicht weniger als das.»
Mehr Mut wünschte man sich von der Bieler Politik auch in Sachen Tempo 30: Gestern Abend hat der Stadtrat ein Postulat für eine nächtliche Temporeduktion von Myriam Roth (Grüne) zwar mit grossem Mehr angenommen, was erfreulich ist. Allerdings verlangt dieses einzig die Prüfung, ob in Biel nachts punktuell Tempo 30 eingeführt werden könnte. Der Gemeinderat unterstützte in seiner Antwort das Anliegen, wollte aber vorerst die Auswertung eines entsprechenden Pilotprojekts in Lausanne abwarten.
Warum so zaghaft? Sogar die WHO empfiehlt ein Tempolimit von 30km/h im Siedlungsgebiet. Längst gibt es eine breite Palette von Erfahrungen aus Innenstädten weltweit die zeigen, dass Tempo 30 ein wichtiger Faktor ist für mehr Lebensqualität und Sicherheit in der Stadt.
Deshalb gilt auch für Biel: Es ist höchste Zeit für mehr Tempo bei der Temporeduktion und eine entschlossene Umgestaltung des öffentlichen Raums zugunsten von Fussgänger:innen, Velofahrenden und Lebensqualität in der Stadt. Mit schönen Bildern und wortreichen Versprechungen ist leider noch nichts erreicht.
Immerhin: Beim Umgestaltungsprojekt am Unteren Quai ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sobald das konkrete Projekt im Sommer für die Umgestaltung vorliegt, soll die Bevölkerung mitreden können…
VON DER AUTO-
ZUR VELOSTADT
Das Abstimmungswochenende vom 13. Februar 2022 hat einmal mehr deutlich gezeigt: Biel ist, entgegen der gebetsmühlenartig verbreiteten Behauptung gewisser Politiker, keine Autostadt. Im Gegenteil: Während eine Mehrheit im konservativen Kanton Bern eine Revision der Motorfahrzeugsteuer ablehnte, wonach Autos nicht nur nach Gewicht, sondern auch aufgrund ihres CO2-Ausstosses besteuert worden wären, hat die Stadt Biel dieser Vorlage mit über 61 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt.
In Biel gibt es zudem immer mehr Menschen, die kein eigenes Auto besitzen und einen Grossteil der täglichen Strecken mit dem Velo zurücklegen. Schliesslich eignet sich die Topographie der Stadt auch bestens für dieses konstengünstige und gesundheitsfördernde Verkehrsmittel.
Allerdings ist die Stadt Biel für Velofahrende «kein einfaches, ja teilweise ein gefährliches Pflaster», wie Carmen Stalder im heutigen Bieler Tagblatt anschaulich beschreibt: Es gibt keinen durchgehenden Veloweg von West nach Ost, keine grünen Wellen für Velofahrende und auf vielen Strassen schlicht zuwenig Platz. Die Probleme sind längst erkannt, es gab in der Vergangenheit bereits unzählige politische Vorstösse, der «Sachplan Velo 2035» soll mit 80 Massnahmen Verbesserungen schaffen. Doch konkret bewegt hat sich in den letzten Jahren wenig.
Dem will die Bieler SP nun mit einer neuen Velo-Offensive in Form von Stadtratsvorstössen Abhilfe schaffen, wie sie an ihrer gestrigen Medienkonferenz bekannt gegeben hat. So fordert sie etwa die baldige Einrichtung von Velostrassen, wie sie in anderen Städten längst erfolgreich umgesetzt werden oder die Umnutzung von 40 Autoparkplätzen in der Innenstadt.
«Die Bevölkerung wünscht sich hochwertige, städtische Lebensräume anstelle von Autobahnschneisen», wird Susanne Clauss, Co-Präsidentin der SP Biel, im Bieler Tagblatt zitiert. Und Anna Tanner verweist auf Vorbilder wie Kopenhagen, Amsterdam oder Paris, wo die Dominanz der Autos zugunsten des Veloverkehrs erfolgreich zurückgebunden wurde und stellt fest: «In Biel sind die Rechte für Auto- beziehungsweise Velofahrende sehr unverhältnismässig verteilt.»
Die Situation für Velofahrende müsse rasch verbessert werden, betonen die SP-Politiker:innen und verweisen auf die positiven Auswirkungen der Förderung des Veloverkehrs: Verringerung von Verkehrslärm und Luftverschmutzung, Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, vermehrter Einsatz von Fahrrädern als günstige Transportmittel…
Es gibt noch viel zu tun, um Biel in eine velofreundliche Stadt zu transformieren. Die gute Nachricht: Ein Grossteil der notwendigen Massnahmen kann rasch und konstengünstig umgesetzt werden.
DER GÜRBETALER 007
AUFREGUNG UM WOZ-ARTIKEL
«Neuhaus giesst Öl ins Feuer» titelt das Bieler Tagblatt vom 12. Februar 2022. In seiner wohlbekannten flapsigen Art hat der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus gegenüber der Wochenzeitung WOZ erklärt, eine Schliessung der sogenannten Autobahn-Netzlücke in Biel würde vom Bund nur mitfinanziert, wenn es auch «zusätzliche Anschlüsse» gebe.
Eine Aussage, die provoziert: Die Empfehlungen aus dem Dialogprozess schliessen künftige «Anschlüsse im Siedlungsgebiet» nämlich unmissverständlich aus. Der vom Kanton für die fachliche Begleitung des Dialogprozesses mandatierte Städtebauexperte Han van de Wetering nannte denn auch kürzlich im Interview mit der IG Häb Sorg zur Stadt als verpflichtendes Ergebnis des Runden Tisches, dass feststehe: «Innerhalb des Siedlungsgebiets der Städte Biel und Nidau kann es künftig keinen weiteren Autobahnanschluss geben. Dies hat der Dialogprozess deutlich gemacht.»
Und nun prescht der kantonale Baudirektor vor und behauptet das Gegenteil. Was den Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr in Rage bringt. Gegenüber dem Bieler Tagblatt kommentiert er: «Ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen den Anschlüssen und der Finanzierung durch den Bund. Wie man im jetzigen Stadium der Arbeiten behaupten kann, dass eine Nationalstrasse im Raum Biel nur mit Anschlüssen eine Wirkung erzielen kann, ist mir schleierhaft.»
Was gilt nun? Fakt ist, dass eine Machbarkeitsstudie für einen Langtunnel zeitnah in Auftrag gegeben werden soll. Nicht aus der Luft gegriffen ist auch die Aussage von Neuhaus, dass ein Tunnel ohne Ausfahrt «von Pieterlen bis La Neuveville» vom Bund nicht finanziert wird, da er zuwenig Frequenzen generieren würde. Dass der Bund nur Strassenprojekte (mit)finanziert, die gewisse Frequenzen aufweisen, war ja bereits bei der alten Westast-Planung ein Thema…
Fakt ist zudem: Für das Astra haben weder die «Schliessung der Netzlücke» noch der Bau eines Tunnels in Biel oder Port Dringlichkeit. Dort wartet man mal ab, was der Kanton Bern vorlegen wird. Mit anderen Worten: Die Region Biel hätte hier freie Hand, jetzt ein für alle Mal innovative Lösungen voranzutreiben.
Stattdessen plant man – auch im Rahmen von Espace Biel/Bienne.Nidau weiterhin an Autobahn-Grossprojekten. Eine Altlast aus den vorschnellen Kompromissen des Dialogprozesses: Jetzt zeigt sich, dass das Einlenken, auf den sich eine Mehrheit der Westast-Gegnerschaft eingelassen hatte, ein wahrer Pferdefuss ist: Die Zustimmung zur Schliessung der «Netzlücke» und zum Porttunnel haben zur Folge, dass der Streit um diese langfristigen «Lösungen» bessere Entwicklungen blockiert oder gar verunmöglicht.
Befeuert wird diese Fehlentwicklung noch durch die Wirtschaftsverbände der Entente Bernoise und den TCS-Bern-Mittelland, die diese Woche anlässlich einer Medienkonferenz gefordert haben, dass Wirtschaftsvertreter:innen künftig «konsequenter und verbindlicher als bisher» in die Verkehrsplanung einbezogen werden. Sie plädieren dabei für «Mut zu visionären Projekten» – und benennen auch gleich, was sie darunter verstehen: «eine Autobahn-Südumfahrung von Bern und die Fertigstellung der Autobahn Bern-Biel. Gemeint sind durchgehend vier Spuren und der Bau des Westastes.»
Eine ernüchternde Zwischenbilanz: 14 Monate nach dem gefeierten «Westast-Kompromiss» drücken die Autobahnturbos wieder aufs Gaspedal. Statt dass man die konstruktiven Empfehlungen, die der Dialogprozess ergeben hat, zügig anpackt und an deren Umsetzung arbeitet, dreht sich wieder alles um Autobahn- und Tunnelbau.
DROHT EIN SCHERBENHAUFEN?
Es läuft was in Sachen Planung und Verkehr, in der Region Biel. Aber offenbar läuft auch einiges schief…
Wie sonst ist zu verstehen, dass die AareSeelandMobil (ASM) klammheimlich versucht, Liegenschaften für einen Doppelspurausbau der BTI-Bahn zusammenzukaufen, von dem die Behörden der Stadt Biel nichts wissen – jene in Nidau aber schon, wie die Recherche des Bieler Tagblatts vom 15. Januar zeigt?
Die oberirdisch geführte Doppelspur mitten durch Wohnquartiere ist ein höchst umstrittenes Projekt, das hinterfragt und grundsätzlich erörtert gehört. Gerade im Hinblick auf die Stadt- und Regionalentwicklung, für die sich mit der Abschreibung des Westasts eine ganz neue Ausgangslage rund um den Bieler Bahnhof eröffnet.
Das Gleiche gilt für die leidige Geschichte rund um den Porttunnel: Geht es nach den Gemeindebehörden von Port und Nidau, soll dieser weiterhin gebaut werden und zwar genau wie im abgeblasenen Westastprojekt geplant. Obschon er heute noch weniger Sinn machen würde als zuvor – und das ASTRA als Milchkuh für dessen Finanzierung kaum mehr in Frage kommen dürfte.
Nun ist um diesen Porttunnel gar ein offener Streit ausgebrochen, da sich die Gemeinde Ipsach – verständlicherweise – quer stellt: Ein Tunnelportal mitten im Dorf würde Ipsach nichts als Mehrverkehr bringen, argumentiert Gemeindepräsident Bernhard Bachmann gegenüber dem Bieler Tagblatt vom 31. Januar. Sein Lösungsvorschlag: Wenn schon ein Tunnel, dann ein langer, dessen Ende hinter Ipsach, an die Gemeindegrenze zu Sutz zu liegen käme.
Doch auch dies wäre keine Lösung, damit würden die Probleme einmal mehr bloss verschoben. Deshalb rät Städtebauexperte Han van de Wetering dringend, das Ganze noch einmal zu überdenken: «Man sollte nicht noch einmal dieselben Fehler machen wie beim Westast», sagte er gegenüber dem BT. «Das Ganze neu denken zu können, ist eine grosse Chance, kein Zeitverlust. Man sollte nicht zu viel daran denken, was man schon alles gemacht hat, da ist man nur frustriert. Aber wenn man ein schlechtes Projekt umsetzt, hat man am Schluss die grösseren Probleme.»
Han van de Wetering hat übrigens im Auftrag von «Espace Biel/Bienne.Nidau» das im Westast-Dialogprozess entstandene Zukunftsbild noch einmal überarbeitet. Dieses soll laut unseren Informationen an einer nächsten Sitzung der Behördendelegation und anschliessend auch der Reflexionsgruppe zur Beurteilung vorgelegt werden.
Wann es soweit ist, steht in den Sternen. Fakt ist: Bis heute* wurde den Mitgliedern der Reflexionsgruppe von «Espace Biel/Bienne.Nidau» noch kein einziges Sitzungsdatum für 2022 kommuniziert. Dabei gäbe es Wichtiges zu diskutieren, wie obige zwei Beispiele zeigen.
Wie ist die abermalige Funkstille zu interpretieren? Einfach als Nachlässigkeit und weiteres Zeichen dafür, wie lästig und unwichtig für Stadtpräsident Fehr und Stadtpräsidentin Hess die weitere Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des ehemaligen Runden Tischs ist? Oder steckt mehr dahinter? Möglicherweise gar ein Scherbenhaufen? Wenn man bedenkt, dass Biel und Nidau in wichtigen Punkten offenbar nicht miteinander kommunizieren, und sich Mitglieder der Behördendelegation in aller Öffentlichkeit einen Schlagabtausch leisten.
* Stand Mittwoch, 2. Februar 2022. – Keine 24 Stunden später, am Donnerstag, 3. Februar um 7.00 wurde vom Berner Tiefbauamt die Mail mit den Sitzungsdaten für 2022 verschickt – das kann kein Zufall sein…
Vorgesehen sind auch dieses Jahr bloss vier Termine – davon fällt keiner ins erste Quartal! Das nächste Treffen der Reflexionsgruppe ist erst für Donnerstag, 6. April vorgesehen. Also erst in gut zwei Monaten!
BTI-BAHN 2040:
JETZT BLOSS KEINEN BARRIEREN-BLÖDSINN AUFGLEISEN!
Vor fast genau 100 Jahren ist der Stadt Biel ein grosser Wurf gelungen. 1923 haben kluge Köpfe den Bahnhof Biel an neuer Stelle gebaut und damit auch die heutige Linienführung festgelegt. (…)
Fast hundert Jahre später haben andere kluge Köpfe in Biel ein Projekt für einen Autobahnanschluss beim Bieler Bahnhof in der Versenkung verschwinden lassen. Das hat viele Planungsvorhaben rund um den Bahnhof völlig über den Haufen geworfen. So auch die Planung für einen Doppelspurausbau der BTI-Strecke zwischen Biel und Nidau. (…)
Statt Land aufzukaufen und neue Wunden im Stadtkörper zu planen, wie dies die Verantwortlichen der BTI-Betreiberin Aare Seeland Mobil gegenwärtig tun, wäre es jetzt an der Zeit, eine langfristige und umfassende Lösung zu suchen. Unter dem Strassenniveau, ohne Barrierenanlagen: Die Metro BIENNE…
Dafür braucht es jedoch jetzt dringend erneut kluge Köpfe…
«DIE KONTROVERSE IST NICHT GELÖST»
 Der Architekt und Stadtplaner Han van de Wetering hat den Westast-Dialogprozess als «Fachexperte Städtebau» begleitet. Im Gespräch mit der IG Häb Sorg zur Stadt spricht er über die Ergebnisse des Runden Tischs – und die Gefahr, dass diese in der aktuellen Diskussion zu wenig berücksichtigt werden.
Der Architekt und Stadtplaner Han van de Wetering hat den Westast-Dialogprozess als «Fachexperte Städtebau» begleitet. Im Gespräch mit der IG Häb Sorg zur Stadt spricht er über die Ergebnisse des Runden Tischs – und die Gefahr, dass diese in der aktuellen Diskussion zu wenig berücksichtigt werden.
Wir hatten uns mit Han van de Wetering Anfang November 2021 an der Rendez-vous Veranstaltung von Espace Biel/Bienne.Nidau spontan getroffen. Er war angereist, um im Auftrag der Projektleitung als Auskunftsperson und Experte die «Partizipationsveranstaltung» zu begleiten. Die aktuellen Entwicklungen in Sachen Post-Westastplanung machen ihm Sorgen, insbesondere ist er enttäuscht über den Rückfall in alte Denk- und Diskussionsmuster: «Im Dialogprozesss haben wir es schliesslich geschafft, dass man nicht immer nur über Strassenvarianten debattierte, sondern dass Städtebau und Verkehr gleichwertig behandelt wurden. Davon ist heute, vor allem in der Medienberichterstattung, nichts mehr zu spüren», bedauerte er im kurzen Austausch zwischen Tür und Angel. Ende 2021 haben wir seine planerischen Überlegungen im Rahmen eines Zoom-Meetings vertieft diskutiert.
Interview: Gabriela Neuhaus
GN: Wie beurteilen Sie, ein Jahr nach dem Abschluss des Dialogprozesses, die Situation?
Han van de Wetering: Die Kontroverse ist nicht gelöst – wir sind noch nicht am Ziel. Fest steht jedoch: Innerhalb des Siedlungsgebiets der Städte Biel und Nidau kann es künftig keinen weiteren Autobahnanschluss geben. Dies hat der Dialogprozess deutlich gemacht. Was gut ist: Man hat sich darauf geeinigt, Städtebau und Verkehr bei der künftigen Entwicklung als Ganzes zu betrachten. Dabei hilft das Zukunftsbild, das aus dem Dialogprozess hervorgegangen ist. Ich habe diese Planungsgrundlage nun noch einmal überarbeitet und ergänzt. Während in der ersten Version die geplante Überbauung Agglolac beispielsweise noch eine wichtige Rolle spielte, fällt dieses Grossprojekt nun weg. Auch der Porttunnel wurde ausgeklammert. Dafür haben wir verschiedene Inputs aus der Bevölkerung aufgenommen, und der Schlachthof als schützenswerter Zeitzeuge ist prominenter aufgeführt. Zudem wurde dafür plädiert, den Betrachtungsperimeter zu erweitern und u.a. das linke Bielerseeufer miteinzubeziehen. Ein wichtiges Thema sind nicht-bauliche Lösungen. Man muss nicht immer alles nur in Beton denken! Mit Massnahmen wie Dosierung, Tempoanpassungen, Parkplatzbewirtschaftung oder auch Raumplanung kann man sehr viel erreichen. Deshalb ist es gut, hat der Dialogprozess die kurz- und mittelfristigen Massnahmen benannt, die zur Problemlösung beitragen.
©HvdWetering
GN: Trotzdem hat man den Eindruck, bei den Behörden stehe nach wie vor die «Schliessung der Netzlücke» im Zentrum und nicht die städtebauliche Gesamtsicht…
Han van de Wetering: Ob beim Rosengartentunnel in Zürich oder beim Westast in Biel – überall macht man die gleichen Fehler: Irgendwann liegt der Plan für ein Umfahrungs- oder Anschlussbauwerk vor, ohne dass vorgängig die Frage gestellt wurde, was eigentlich das Gesamtziel sein soll.
Im Städtebau gibt es für jedes grössere Projekt zuerst einmal Studienaufträge, einen Wettbewerb und einen langen Prozess der Mitwirkung. Auch bei der Planung von Verkehrsinfrastruktur bräuchte es ein solches Verfahren, weil es sich hierbei ebenfalls um raumwirksame Projekte handelt, die prägend sind für eine Stadt. Wir brauchen dringend eine andere Planungskultur, – dass man heute fixfertige Pläne vorlegt, ohne vorgängig grundsätzliche Fragen gestellt zu haben, ist absurd…
DROHT NACH DEM WESTAST-AUS
DIE BTI-SCHNEISE?
Noch kein Jahr ist es her, dass der Enteignungsbann im Planungsperimeter für die Westast-Autobahn aufgehoben wurde. Nach Jahren des Stillstands und des angedrohten Verlusts ihrer Häuser konnten die Bewohner:innen und Liegenschaftsbesitzer:innen endlich aufatmen und wieder nach vorne schauen. Denn in einen Umbau oder in «nicht notwendigen» Unterhalt ihrer Häuser war ihnen während Jahren verboten gewesen, zu investieren.
Doch lange währte die Freude nicht. Denn schon drohen wieder Enteignung und Abriss, für ein nächstes Planungsmonster: Das Bahnunternehmen Aare Seeland mobil AG (asm) will zwischen dem Bahnhof Biel und Nidau den Doppelspurausbau. Laut eigenen Angaben werde dies zwar «erst ab 2040 ein Thema». Trotzdem gehen die Bahnbosse bereits heute auf Einkaufstour. Wohl mit dem Ziel, sich die während Jahren durch die Westastplanung blockierten Liegenschaften möglichst günstig zu sichern. Klar: Für die angepeilte Erweiterung des Bahntrassees braucht es zusätzlich Land.
Ein Teil der Liegenschaften an der Gurnigelstrasse, die dem Ausbau der BTI-Bahn weichen müssten, sind aktuell im Besitz des Kantons. Dieser hatte die Häuser im Hinblick auf deren Abriss für den Bau des Westasts gekauft – und will sie nun wieder abstossen. Da scheinen die Kaufinteressen von Seiten des Bahnunternehmens gerade recht zu kommen.
Akut bedroht von diesen Plänen ist aber auch das Schlachthofareal: Ein Blick auf die Karte lässt unschwer erkennen, dass die denkmalwürdige Villa an der Murtenstrasse 68 – das ehemalige Direktionsgebäude – dem Bahntrassee geopfert werden müsste. Dies, obschon die Denkmalpflege das Schlachthofareal als Gesamtensemble als schützenswert einstuft.
Besonders stossend an der Geschichte: Offenbar werden hier einmal mehr hinter verschlossenen Türen Weichen gestellt. Heimlich, still und leise. Ganzheitliche Stadtplanung unter Einbezug der betroffenen Bevölkerung, wie dies im Westast-Dialog versprochen wurde, geht anders!
Es ist kaum anzunehmen, dass man bei der Stadt Biel über die Ausbaupläne der asm nicht informiert ist. Nichtsdestotrotz hat Florence Schmoll, Leiterin der Stadtplanung Biel, gegenüber der IG Schlachthof Kulturzentrum in einem ausführlichen Gespräch noch Ende November 2021 wiederholt versichert, es gebe aktuell keine Planung für irgendwelche baulichen Veränderungen im Perimeter Salzhaus‑, Murten- und Gurnigelstrasse oder für das Schlachthofareal.

Fakt ist: Eine Trassee-Erweiterung für die BTI-Bahn würde neue Wunden ins historisch gewachsene Siedlungsgebiet zwischen Nidau und Biel schlagen. Dass dieser Ausbau vielleicht nice-to-have, aber weder dringend noch notwendig ist, wurde bereits von Verkehrsfachleuten untersucht und bestätigt.
Ob und wie die Linienführung der Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI) zwischen Nidau und Biel, die in der Tat einige Knackpunkte aufweist, erneuert und verbessert werden kann, müsste deshalb zwingend in einem umfassenden und partizipativen Entwicklungsprozess erörtert und erarbeitet werden. In eine solche Betrachtung einbezogen werden müsste insbesondere auch das unsinnige Verkehrshindernis mit Barrieren-auf-und-zu an der Querung Bernstrasse.
Warum eigentlich wurde bis anhin nie in Betracht gezogen, die BTI-Bahn zwischen Nidau und dem Bahnhof Biel unterirdisch zu führen? Mit einer solchen Tunnelvariante könnte tatsächlich Stadtraum geschont, gewonnen und aufgewertet werden!
Es geht nicht, dass die Automobil Seeland mobil AG mit dem Kauf von Liegenschaften nun vorprellt und die Weichen für einen Infrastrukturausbau stellt, der so noch gar nicht diskutiert, geschweige denn beschlossen ist.
Oder kommt es der Stadt Biel etwa gerade gelegen, dass die asm als Winkelried vorgeschickt wird, um das Schlachthof-Ensemble zu zerstören? Was zur Folge hätte, dass das verbleibende Areal an Toplage in Bahnhofsnähe ohne mühsame Opposition durch die Denkmalpflege einer lukrativen Nutzung zugeführt werden könnte…
Nachtrag:
Die Stadt Biel hat die von der IG Häb Sorg zur Stadt gestellte Frage gegenüber der Journalistin Deborah Balmer, die in dieser Sache gründlich recherchiert hat, indirekt beantwortet: Im Bieler Tagblatt vom Samstag, 15. Januar sagt Biels Stadtplanerin Florence Schmoll deutsch und deutlich: «Wir haben keine Kenntnis darüber, dass die ASM Ausbaupläne hegt.»
Mit anderen Worten: Die Stadt Biel wurde offenbar – im Gegensatz zur Gemeinde Nidau – von der ASM in Bezug auf deren Ausbaupläne bislang nicht kontaktiert. Und ist dem Vorhaben nicht positiv gesinnt, wie Florence Schmoll weiter ausführt: Es sei wichtig, wird sie im Bieler Tagblatt weiter zitiert, den Einfluss des ASM-Bähnlis auf das Stadtgebiet auch künftig klein zu halten: «Wir ziehen ein Nebeneinander von Autos und Bahn im Mischverkehr, so wie das heute der Fall ist, vor. Die Fläche, die die ASM beansprucht, muss auch in Zukunft so klein wie möglich sein.»
Eine gute Nachricht fürs Gurnigelquartier und den Schlachthof. Gleichzeitig hält die ASM jedoch daran fest, dass es aus ihrer Sicht bis in 20 Jahren einen Ausbau auf Doppelspur zwischen Nidau und Biel brauche. Eine Behauptung, die von Fachleuten bestritten wird. Auf die Fortsetzung der Geschichte darf man gespannt sein…
Bieler Tagblatt, 15. Januar 2022:
TATSACHEN UND
BEHAUPTUNGEN
Vor gut zwei Wochen hat uns Regierungsrat Christoph Neuhaus über seinen Lieblingskanal Facebook der Verbreitung von «Fake News» bezichtigt. Unsere Feststellung, dass der Kanton, statt bei den kurz- und mittelfristigen Massnahmen Prioritäten zu setzen, an einem Juratunnel plane, sei gelogen, so der Berner Baudirektor.
Auch der Bieler Stadtpräsident und Vorsitzende von Espace Biel/Bienne.Nidau wird nicht müde zu behaupten, die Planung eines Juratunnels würden in weiter Ferne liegen. «Wie man auf diese Idee kommt, ist mir schleierhaft», lautete seine Antwort auf eine entsprechende Frage – nachzulesen im Bieler Tagblatt vom 26. November.
Die Behörden üben sich in Wortklaubereien und Nebelkerzenzünden. Wenn im Berner Verwaltungsdeutsch «Machbarkeitsstudien» und «Planung» nichts miteinander zu tun haben sollen, dann mag das in der Schaf- und Herdenschutzhundezucht gelten. Fakt ist aber, dass eine Machbarkeitsstudie die Grundlage einer Planung bildet und somit umgangssprachlich sehr wohl als erster, wesentlicher Schritt im Hinblick auf die Erstellung eines Bauwerks gilt.
Das mit der Planung ist sowieso etwas speziell im Departement Neuhaus. Ein Blick ins Geoportal des Kantons Bern, wo das Strassennetz des Kantons (gebaut und geplant) dargestellt wird, hilft da auch nicht weiter: Da hinkt man offenbar, fast ein Jahr nach der Abschreibung des Westast-Ausführungsprojekts, den Tatsachen hinterher: In frischem Hellgrün leuchten hier immer noch der alte Westast sowie der Porttunnel als «Nationalstrasse geplant». – Was hingegen fehlt, ist der geplante Twanntunnel, gegen den aktuell vor Verwaltungsgericht Beschwerden hängig sind.
Fakt ist: Statt den Fokus auf rasch umsetzbare und wirksame Massnahmen zu richten, wird viel Zeit und Geld für neue Tunnelprojekte in alter Manier verschwendet. Die einen nennen es «Machbarkeitsstudie», die anderen «Planung». So oder so – die Prioritäten sind einmal mehr falsch gesetzt.
Als zentrale Aufgaben fokussiert EBBN auf drei Schwerpunkte – nebst der «Achse Brüggmoos-Neuenburgstrasse» sind dies namentlich die beiden Tunnelprojekte Port- und Juratunnel. Dies geht sowohl aus den Unterlagen von EBBN hervor wie aus verschiedenen Gesprächen mit Behördenmitgliedern.
Dies in einer Zeit, wo Nachhaltigkeit und Umdenken notwendiger sind denn je. Eine Botschaft, die offenbar noch nicht bei den Entscheidungsträger:innen angekommen ist. Die Tunnelpläne stehen letztlich nicht nur in krassem Widerspruch zu den Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung, sondern auch zu den aktuellen Mobilitätstrends, wie dem Mitte November vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE publizierten Schlussbericht Verkehrsperspektiven 2050 zu entnehmen ist.
Dessen Zukunftsszenarien basieren zwar nach wie vor auf der Annahme, dass Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum weitergehen (müssen). Gleichzeitig wird aber klar darauf verwiesen, dass der Verkehr künftig weitaus weniger stark wachsen wird als die Bevölkerung.
Veränderungen im Mobilitätsverhalten sind nicht nur dringend notwendig, sondern bereits voll im Gang. Stichworte dazu sind etwa E‑Bikes oder Home Office. Um den Verkehr jedoch wirklich in nachhaltige Bahnen zu lenken, bräuchte es deutliche Massnahmen, die mit Qualitätsverbesserungen für den Fuss‑, Velo- und öffentlichen Verkehr diesen attraktiver machen, sowie Lenkungsmassnahmen wie Parkplatzmanagement oder Überwälzung der externalisierten Kosten auf die Autofahrer:innen.
Massnahmen, die in den Empfehlungen aus dem Dialogprozess sehr wohl aufgeführt sind. Offensichtlich haben sie aber in der Strategie von EBBN keine Priorität: Diese schert sich einen Deut um die Umsetzung der Empfehlungen der Dialoggruppe, sondern fokussiert geradezu hektisch auf die Machbarkeit eines langfristigen Betoninfrastrukturprojekts, dessen Nutzen zuerst noch bewiesen werden müsste. Dass die Region Bielersee mit der Schliessung der vielzitierten «Autobahnlücke» mit zusätzlichem Autoverkehr überschwemmt werden könnte, können sich die Strategen von EBBN offenbar schlicht nicht vorstellen.
Dass sie dabei absurderweise flankiert und unterstützt werden von den lokalen Funktionären von VCS, Pro Velo, IG Fussverkehr, Heimatschutz und Netzwerk Bielersee weckt in der Region Bielersee böse Erinnerungen an die berüchtigte «Arbeitsgruppe Stöckli». Wie damals wollen die Behörden und gewisse Funktionäre der Fachverbände auch jetzt ihr Ding durchziehen – und die Bevölkerung aussen vor lassen. Nur gut, dass Bürgerinnen und Bürger mittlerweile dazu gelernt haben…
NACH DEM AUFATMEN
DAS DEFINITIVE AUS
Die Lage ist einmalig: Keine fünf Minuten zu Fuss zum Bahnhof – Schulen, Einkaufszentren und sogar die beiden Stadtzentren von Biel und Nidau in Gehdistanz. Einst stand hier – gegenüber vom Schlachthof – das legendäre Restaurant Schönegg mit seinem lauschigen Biergarten, dem Pavillon und dem Badhaus an der Madretschschüss. Heute wundern sich Passantinnen und Passanten über die verwilderte Brache, eine klaffende Lücke mitten in der Stadt.
Grund dafür ist die jahrelange Westast-Planung, welche die Umsetzung des bereits angefangen Bauprojekts verunmöglicht hat. Zuerst waren es bloss Gerüchte, dann folgten behördliche Hinhaltemanöver, die schliesslich 2016 in einem Enteignungsbann gipfelten. Bei einem Besuch in seiner Werkstatt erzählte uns Daniele De Falcis die schier unglaubliche Leidensgeschichte, die er sich mit dem Kauf der Parzelle 5376 eingehandelt hat. ZUR GESCHICHTE
Als sich vor einem Jahr abzeichnete, dass der Westast mit dem Anschluss Bienne-Center wohl definitiv abgeschrieben wird, schöpfte Daniele De Falcis neue Hoffnung. Damals glaubte er, sein seit 15 Jahren sistiertes Bauprojekt nun bald zu einem guten Ende bringen zu können.
Er wurde jedoch erneut enttäuscht: Die Baubewilligung sei längst verfallen, das vorliegende Projekt sei veraltet, hiess es bei der Stadt. Weil sich die seine Parzelle zudem in einer Zone mit Planungspflicht befindet, liegt die Federführung der Grundstücksentwicklung zudem vorderhand bei der Stadt. Diese hat mittlerweile ein Architekturbüro ihrer Wahl mit einer Testplanung beauftragt.
Trotz bald 20jährigem Spiessrutenlauf hat Daniele de Falcis die Hoffnung nicht aufgeben: Gerne würde er ein neues zeitgemässes Projekt zum Fliegen bringen – auch wenn er noch einmal zwei bis drei Jahre Geduld aufbringen muss, bis Bauarbeiten gestartet werden könnten.
AUFSCHLUSSREICHE
RECHERCHE
Gut, wurde das Komitee «Westast so nicht!» gerettet. Der neue Vorstand hat bereits einiges in Bewegung gebracht. Anlässlich der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 3. November legten die gut 50 anwesenden Mitglieder gemeinsam die künftigen Schwerpunkte der Vereinsarbeit gemeinsam fest. Dabei entschieden sie, insbesondere auf das Monitoring und die Transparenz in Bezug auf die Ergebnisse aus dem Dialogprozess zu fokussieren.
Wie wichtig das leider ist, zeigt eine aufschlussreiche Recherche, die der Infosperber am letzten Samstag, 13. November publiziert hat. Unter dem Titel «Das Bieler Westastmonstser ist zurück» zeigt Komitee-Vorstandsmitglied Catherine Duttweiler auf, welch falsches Spiel die Behörden bei der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess spielen.
Nur nach zähem Ringen unter Berufung auf das Öffentlichkeit erhielt das Komitee überhaupt erst Einblick in die Protokolle der Behördendelegation und der Projektkomission. Weshalb deren Vorsitzende Fehr und Hess diese am liebsten ganz unter Verschluss halten würden, wird bei der Lektüre des Infosperber-Artikels schnell klar:
Aus den Dokumenten geht hervor, dass die westastkritischen Organisationen mit ihrer schon lange geäusserten Vermutung, dass der Juratunnel von Seiten der Behörden im Gegensatz zu den meisten anderen Empfehlungen stark gepusht werde, völlig richtig liegen. Mehr noch: Sogar ein innerstädtischer Anschluss in der Bieler Seevorstadt steht wieder zur Debatte!
Catherine Duttweiler verweist in ihrem Artikel auf erschreckende Parallelen zwischen dem selbstherrlichen Vorgehen der Arbeitsgruppe Stöckli, die vor 10 Jahren den Westast mit aller Gewalt durchzupeitschen versuchte und den aktuellen Entwicklungen bei Espace Biel/Bienne.Nidau.
Immerhin besteht Hoffnung, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zu damals: In der Zwischenzeit hat die Bevölkerung in der Region Biel gelernt, den Behörden auf die Finger zu schauen. Sie wird diesmal nicht mehr warten, bis ihnen die Behörden ein weiteres stadtzerstörerisches Projekt auftischen. Zumal es ja ein ganzer Katalog von nachhaltigeren und kostengünstiger Massnahmen auf Umsetzung wartet.
DEUTLICHE WORTE
Die sogenannte Rendez-vous Veranstaltung von Espace Biel/Bienne.Nidau fand in der ersten Novemberwoche weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet und dies auch kritisiert.
Die wenigen Menschen, die trotz allem den Weg ins Volkshaus gefunden haben, wurden praktisch durchwegs enttäuscht: Die schönen Skizzen zum Zukunftsbild an den Wänden enthielten wenig Konkretes, Informationen über den tatsächlichen Stand der Arbeiten gab es kaum.
Die Behörden wollen uns weismachen, es gebe nicht mehr zu berichten. Tatsache ist jedoch: Sie wollen nicht informieren! Dies, weil Transparenz und Information über laufende Arbeiten immer das «Risiko» bergen, dass sich die Bevölkerung dazu äussern und vielleicht gar eigene Inputs einbringen möchte. Das will man mit aller Macht verhindern.
Fakt ist: Hinter den Kulissen arbeitet man längst an der neuen Planung – sowohl auf kommunaler wie auf regionaler Ebene. Manche Projekte, wie etwa der Porttunnel, werden dabei besonders gepusht. Baudirektor Christoph Neuhaus behauptete kürzlich in seiner bewährten Manier auf Facebook sogar, die Finanzierung dieses umstrittenen Infrastrukturprojekts sei bereits gesichert…
Dies, obschon sich in Sachen Monitoring, einer unabdingbaren Voraussetzung für die weitere Planung und deshalb auch eine zentralen Forderung aus dem Dialogprozess, bisher noch kaum etwas bewegt hat, wie letzte Woche im informellen Gespräch von kompetenter Seite bestätigt wurde.
Leider haben die Behörden die Lektion immer noch nicht begriffen. Carmen Stalder findet in ihrem Wochenkommentar vom letzten Samstag im Bieler Tagblatt denn auch deutliche Worte: «Die Projektorganisation hat tatsächlich noch keine konkreten Verkehrsmassnahmen präsentiert. Und es ist auch nicht bekannt, welche Empfehlungen die Bieler und Nidauer Behörden im Frühsommer zuhanden von Bund und Kanton priorisiert haben und nun weiterverfolgen. (…)
Die Behörden sollten in diesem heiklen Dossier dringend mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Sie sollten regelmässiger und offener kommunizieren, sie müssen die Menschen mitreden lassen…»
Genau das Gleiche wird auch in zwei Leserbriefen gefordert, die enttäuschte Besucher der Abendveranstaltung vom 2. November geschrieben haben.
click and read
IPSACH UND
DER PORTTUNNEL
Am zweiten Tag der Partizipations-Alibiübung «Rendez-vous» zur städtebaulichen und verkehrlichen Zukunft der Region Biel verschickte der Gemeinderat von Ipsach eine Mitteilung, in der er sich klipp und klar gegen den Porttunnel, wie er als Teil des Westast-Gesamtprojekts geplant wurde, ausspricht.
Stattdessen fordert er eine Langvariante für den Porttunnel. Die Begründung ist naheliegend und nachvollziehbar: Die Ausfahrt des Porttunnels, wie er als Teil des Westast-Ausführungsprojekt geplant war – und für dessen Bau insbesondere Nidau und Port nach wie vor kämpfen – wäre mitten in Ipsach und würde das Dorf in keiner Art und Weise vom Durchgangsverkehr entlasten, im Gegenteil.
Deshalb will der Gemeinderat, dass bei der künftigen Planung die Möglichkeit einer Verlängerung des Porttunnels Richtung Sutz-Lattringen geprüft wird. Eine Forderung notabene, die bereits 2009 auf dem Tisch lag, damals aber von der Arbeitsgruppe Stöckli nicht weiter geprüft wurde.
Realistischer und effizienter als das Festhalten am Bau eines Porttunnels – in welcher Form auch immer – dürfte jedoch die zweite Zielsetzung sein, welche der Ipsacher Gemeinderat in seiner Mitteilung bezüglich Verkehrspolitik formuliert hat: «Der motorisierte Verkehr soll gegenüber heute das Kerngebiet nicht zunehmend belasten. Dies bedingt die konsequente Förderung des öffentlichen Verkehrs und der aktiven Mobilität (insbesondere des Fuss- und Veloverkehrs). Um dies zu erreichen, braucht es einen vermehrten Austausch mit den Nachbargemeinden. Der Gemeinderat wird einen Verkehrsrichtplan mit Massnahmen zur sicheren und effizienten Abwicklung der Mobilität im Dorf erarbeiten. (…) Dies beinhaltet Massnahmen wie die Verkehrsbeeinflussung am Dorfeingang, die verbesserte Signalisation und Tempo 30. Das Ziel ist eine Siedlungsentwicklung, welche auf den ÖV und die aktive Mobilität ausgerichtet ist.»
Bravo! Dies ist eine Ansage, die Hoffnung aufkommen lässt.
WIE VERMUTET,
WIE BEFÜRCHTET…
PARTIZIPATION ALS
LÄSTIGE PFLICHTÜBUNG?
Regierungsrat Christoph Neuhaus ist extra aus Bern nach Biel gereist. Begleitet wurde er von Kantonsoberingenieur Stefan Studer und weiteren Mitarbeitenden des kantonalen Tiefbauamts. Mit von der Partie waren zudem die beiden aus dem Dialogprozess bekannten «Fachexperten» Fritz Kobi und Han van de Wetering.
Anlass der Reise war der Auftakt zur sogenannten «Partizipationsveranstaltung» von Espace Biel/Bienne.Nidau im Bieler Volkshaus: Unter dem Motto «Rendez-vous» informiert die aus dem Dialogprozess hervorgegangene «übergeordnete Projektorganisation» ÜPO während zweier Tage über den Stand der Dinge.
Im Rahmen einer Ausstellung am Dienstag- und Mittwochnachmittag sowie einer einzigen abendlichen Diskussionsveranstaltung unter «ExpertInnen» wollen die Behörden der Bevölkerung Gelegenheit bieten, sich zu informieren und eigene Anregungen einzubringen, so das Narrativ.
Allerdings dürfte kaum jemand im Vorfeld von diesem Vorhaben erfahren haben: Mangels finanzieller Ressourcen, so die Begründung, verzichteten die Veranstalter auf Plakate und Inserate – aber auch die sozialen Medienkanäle blieben stumm.
Er hoffe, so Baudirektor Neuhaus anlässlich des Medienanlasses zur Eröffnung der Ausstellung, «dass besonders die Jungen die Gelegenheit wahrnehmen und sich zur Gestaltung des Zukunftsbildes äussern. Denn es ist ihre Zukunft, und sie werden dereinst mit den Massnahmen leben müssen, die wir heute planen und bereits realisieren oder realisieren werden.»
Wie wahr, Herr Regierungsrat!
Doch, die Frage sei erlaubt: Wie stellen Sie sich das Mitmachen der Jungen vor? Überhaupt der arbeitenden Bevölkerung? Mitten in der Woche nämlich, müssen die meisten Menschen ihren schulischen und beruflichen Verpflichtungen nachkommen.
Die Mitwirkung an der Gestaltung der Zukunft hingegen ist Freiwilligenarbeit, die in der Freizeit stattfinden muss. Etwas, das die gut bezahlten PolitikerInnen, Kommunikationsfachleute und Fachexperten, die diese Veranstaltung mit unseren Steuergeldern planten und nun durchführen, offenbar nicht bedacht haben.
Oder hat das Ganze System? Tatsache ist, dass bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung von unserer Seite mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass der Termin des Anlasses höchst fragwürdig ist. In welcher realitätsfernen Blase leben die beteiligten PolitikerInnen eigentlich? Eine Ausstellung, die an zwei Halbtagen mitten in der Woche bis 19.00 geöffnet ist, kann sich eigentlich nur an Rentnerinnen und Privatiers richten.
Berufsleute, Hausmenschen und StudentInnen haben unter der Woche andere Verpflichtungen, die arbeiten am Dienstag- und Mittwochnachmittag, Herr Regierungsrat! Trotzdem haben die Behörden an ihrem Fahrplan festgehalten. Im Klartext heisst das: Durchpeitschen von Partizipation als blosse Feigenblatt-Veranstaltung.
Die mangelnde Kommunikation und fehlende Transparenz in Bezug auf die Umsetzungsschritte seit dem Ende des Dialogprozesses lassen eh vermuten, dass die Behörden gar kein Interesse an einem echten Engagement der Bevölkerung haben.
Oder, wie es die Nidauer Stadtpräsidentin Sandra Hess heute klar und deutlich formuliert hat: «Mit dem Abschluss des Dialogprozesses ist die Verantwortung und Entscheidungskompetenz wieder an die Behörden übergegangen. (…) Ein partizipativer Prozess kann und darf diese Rechtsordnung nicht übersteuern oder grundsätzlich in Frage stellen.» Das sagt die Frau, die am Wochenende bei einem Haar abgewählt worden wäre.
Fehlanzeige!
Ein leuchtendes Plakat an prominenter Stelle – genau das braucht es, um einen Partizipationsprozess anzuschieben. Gut gemacht, dachte ich kürzlich beim Verlassen des Bahnhofs, als mein Blick auf das in grossen Lettern angekündigte Rendez vous fiel.
Und freute mich: Ein guter Start für die Partizipationsveranstaltung von Espace Biel/Bienne.Nidau! Um dann beim genauen Hinschauen festzustellen: Fehlanzeige! Das auf dem Plakat prominent angekündigte Rendez-vous ist ein literarisches, und hat nichts, aber auch gar nichts mit Verkehrs- und Stadtplanung zu tun…
Der Zufall wollte es, dass das Sekretariats von Espace Biel/Bienne.Nidau gleichentags am späten Abend eine Rundmail an die ehemaligen TeilnehmerInnen des Dialogprozesses verschickte – mit der Bitte, die Infos zu dieser Rendez-vous Veranstaltung mit dem wenig literarischen Titel «Zukunftsbild rund um Biel mitgestalten» weiterzuleiten.
Im Attachment als PDF ein Flyer, das Programm für das Stadtentwicklungs-Rendez-vous vom 2. und 3. November. Der Flyer wurde laut Auskunft des EBBN-Sekretariats in elektronischer Form auch an Schulen (Gymnasien, Berufsschulen, Fachhochschulen) sowie an Gemeindeverwaltungen und die Medien verschickt, mit der Bitte, auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen.
Die «Partizipationsveranstaltung» mitten in der Woche soll zudem auf Facebook und weiteren Gratiskanälen beworben werden. Auf eine grössere Werbekampagne mit Inseraten, Werbespots oder Plakaten habe man, so die Auskunft von EBBN, aus finanziellen Gründen verzichten müssen…
Nicht, dass EBBN über keine finanziellen Ressourcen verfügen würde. Immerhin wurde die Organisation mit einem stolzen Budget von CHF 820’000 allein für 2021 ausgestattet. Die grossen Brocken des EBBN-Budgets fliessen jedoch nicht in die Partizipation, sondern an Experten. Zum Beispiel, für die Erstellung von Machbarkeitsstudien, etwa im Zusammenhang mit Port- oder Juratunnel…
DIE MÄR VON DER
GROSSEN RUHE
Dem Baubeginn für den SBB-Tunnel bei Ligerz steht nichts mehr im Weg. Für das jüngste Monster-Bauwerk in der langen Geschichte der Flickwerke am linken Bielerseeufer müssen zwei weitere Wunden in die Reblandschaft geschlagen werden: Das Westportal des Tunnels zwischen La Neuveville und Ligerz wird auf der Höhe des bestehenden Strassentunnels in den Berg gerammt, das Ostportal bei Kleintwann gegenüber der kantonalen Fischzuchtanstalt.
Eine langersehnte, willkommene Beruhigung für das gesamte Bielerseeufer, verkünden die Bauherrschaft und ihre Promotoren. Das ist nicht bloss Augenwischerei, sondern eine freche Lüge. Fakt ist: Der Ligerzbahntunnel wird der überwiegenden Mehrheit der Anwohnerinnen und Anwohner am linken Bielerseeufer erhebliche Mehrbelastungen bringen.
Gebaut wird er nämlich in erster Linie, um das letzte Teilstück auf der SBB-Transversalen zwischen Genf und St. Gallen auf Doppelspur zu erweitern. Dieser Ausbau hat zum Ziel, auf der Jurasüdfusslinie noch mehr Güterzüge durchzuschleusen. Weil zugleich die Streckenführung begradigt wird, können die Züge künftig nicht nur öfter, sondern auch schneller durch die Gegend brausen.
Was man den Zugreisenden als sekundensparende Verbesserung verkauft, ist in Tat und Wahrheit mit gewichtigen Nachteilen verbunden. Sie werden künftig durch ein weiteres schwarzes Loch geschleust, wo sie heutzutage noch den Ausblick über den See und besonders den Blick auf das berühmte, idyllische Ligerzerchiuchli geniessen dürfen. Ein veritabler Nackenschlag für den Tourismus in der Region.
PLANGENEHMIGUNG TWANNTUNNEL:
WEITERZUG ANS
BUNDESVERWALTUNGS-GERICHT
Während das Westast-Ausführungsprojekt in Biel und Nidau definitiv Geschichte ist, drücken Kanton und Bund bei einem anderen Strassenbauprojekt weiterhin aufs Gaspedal.
Am 6. August, mitten in den Sommerferien, hat das Bundesamt für Umwelt, Verkehr Energie und Kommunikation UVEK die Plangenehmigung für das «Ausführungsprojekt N05 Twanntunnel Ostportal» erteilt.
Auf den ersten Blick hat es wenig mit dem A5-Westast zu tun. Bei genauerer Betrachtung wird aber klar, dass dieses Projekt eine Schleuse öffnen soll, die den (Schwer-) Verkehr für die nächsten Jahrzehnte mit Priorität am Nordufer des Bielersees entlang führen soll und als Nebeneffekt das Verkehrsaufkommen generieren wird, um erneut die Notwendigkeit für einen Autobahnwestast zu propagieren.
Die Bundesbehörden haben die Argumente, die in den 47 noch hängigen Einsprachen aufgeführt waren, praktisch unisono und pauschal unter den Tisch gewischt. So hält das UVEK etwa an seiner wiederholt geäusserten, unhaltbaren Behauptung fest, es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Verkehrsplanung in Biel und dem geplanten Twanntunnel. Die von verschiedenen Einsprechenden geforderte Sistierung des Tunnels zugunsten einer Gesamtplanung für die ganze Region Biel-Seeland wird von den Behörden deshalb genauso abgelehnt wie Forderungen nach einer Redimensionierung der Baustelleninstallationsplätze oder einer Verlängerung des Tunnels über Wingreis hinaus.
Ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich für eine umweltverträgliche, zukunftsfähige Verkehrsplanung und einen schonungsvollen Umgang mit der geschützten Uferlandschaft engagieren. Denn das geplante Tunnelportal mitten in den Rebbergen würde nicht nur den historischen Weiler Wingreis, der notabene unter Denkmalschutz steht, definitiv verunstalten. Auch das beliebte Restaurant Engelberg mit der wunderbaren Terrasse wäre gefährdet. Der Autobahnstrassenbau hätte damit das letzte Erinnerungsstück des stattlichen Strandhotels vernichtet, das vor bald 40 Jahren fast vollständig der N5-Autobahn hatte weichen müssen.
Es darf nicht sein, dass nun auch noch dieser kleine Rest der idyllischen Strandanlage in Wingreis durch eine langjährige lärmige Baustelle zerstört wird. Eine Baustelle notabene, die völlig unnötig ist und an den wahren Bedürfnissen der Bevölkerung am linken Bielerseeufer vorbeizielt und die Reblandschaft weiter verschandelt
Noch ist es Zeit, dem ewigen Flickwerk am Nordufer des Bielersees ein Ende zu setzen! Mit ein paar klugen Massnahmen, wie etwa einem von Biel bis La Neuveville durchgehenden Tempolimit von 60 km/h sowie einem Transitverbot für den Schwerverkehr könnte vielmehr erreicht werden, als mit einer langjährigen Baustelle für einen Tunnel, von dem gerade mal eine Handvoll Anwohnerinnen und Anwohnern im Dorfkern von Twann profitieren würde.
Fest steht: Wird die Fertigstellung des Twanntunnels auf Teufel komm raus durchgedrückt, dürfte sich die prekäre Verkehrssituation am linken Seeufer weiter verschlimmern: Das ASTRA macht schon heute klar, dass es künftig zwischen Biel und La Neuveville durchgehend Tempo 80 will. Dies würde bedeuten, dass die Ein- und Ausfahrten in Alfermée, Tüscherz und Wingreis über kurz oder lang aus- und umgebaut werden müssten.
Soweit darf es nicht kommen!
Deshalb haben zahlreiche Einsprechende beschlossen, den Plangenehmigungs-Entscheid des UVEK weiterziehen und vor dem Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Sie werden dabei vom Komitee «N5 Bielersee – so nicht!» unterstützt.
Gut möglich, dass sie dort mehr Gehör erhalten. Denn sowohl das Twanntunnel-Projekt wie die Argumentation des UVEK sind definitiv von vorgestern. Deshalb braucht es dringend eine Korrektur. Um endlich den Verkehr in der Region Bielersee durch eine zeitgemässe Mobilitäts- und Umweltpolitik zu steuern.
VIELE WORTE –
(NOCH) WENIG INHALT
Neun Monate nach dem Ende des Dialogprozesses trafen sich die Mitglieder der Reflexionsgruppe gestern Abend zum zweiten Mal im Stadtratssaal. Praktisch alle Organisationen, die am Runden Tisch teilgenommen hatten, waren vertreten. Dies zeigt, wie gross das Interesse ist, bei der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess aktiv mitzugestalten.
Dabei wurde gleich zu Beginn klargestellt: Die Reflexionsgruppe hat «beratende Funktion» – aber keine Entscheidkompetenz. Diese liege allein bei den gewählten Behördenmitgliedern, wie die beiden Sitzungs-Coleitenden Sandra Hess und Erich Fehr wiederholt betonten. Nach dem Dialogprozess sei man nun «zurück in den ordentlichen Strukturen», fasste Fehr zusammen.
Wer beraten will, muss aber informiert sein. Das heisst: Die Mitglieder der Reflexionsgruppe müssten sich im Vorfeld der Sitzungen einen Überblick verschaffen können, was in Sachen Planung und Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess aktuell ansteht.
Davon war allerdings gestern erneut wenig Konkretes zu erfahren. Vielmehr drehte sich die Diskussion um die künftige Funktion und Organisation der Reflexionsgruppe. Als Basis diente ein dürrer Entwurf, der den Anwesenden zur Diskussion vorgelegt wurde. Dieser bedarf dringend der Präzisierung und Konkretisierung, damit die Reflexionsgruppe nicht wie einst die Arbeitsgruppe Stöckli zu einem Abnickgremium und Feigenblatt verkommt. Entsprechende Inputs haben die Anwesenden gestern Abend geliefert.
Der gestrige Abend zeigte auch, dass es dringend eine «neutrale» Leitung für die Reflexionsgruppen-Sitzungen braucht: Verschiedentlich kam es aufgrund kritischer Fragen aus dem Saal zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den sich angegriffen fühlenden Co-Leitenden Fehr und Hess. Diese traten allerdings der Forderung nach einer anderen Lösung für die Leitung der Reflexionsgruppe mit der Begründung entgegen, eine aussenstehende Moderation/Sitzungsleitung wäre zu teuer – es sei einfacher und zielführender, wenn sie als Mitglieder der Behördendelegation und Vorsitzende von Espace Biel.Bienne/Nidau auch gleich die Reflexionsgruppe leiten würden. Fakt ist jedoch: Auch und gerade für die Partizipation braucht es ein Budget!
Wenn weiterhin Millionen für technische Strassen- und Städtebauexpertisen zur Verfügung stehen, man aber bei der Partizipation spart, kommen wir nicht weiter: Die Vergangenheit hat mehrfach gezeigt, was mit teuren Studien und Planungen passiert, wenn sie die Herausforderungen und Bedürfnisse der heutigen Zeit und der Bevölkerung nicht berücksichtigen.
Obschon sich die Sitzung in die Länge zog, wurden wichtige traktandierte Themen schliesslich nur am Rand gestreift. Es war schon nach halb Zehn, als der Sekretariats-Beauftragte Hansjörg Ryser von FR&Partner das Projekt eines geplanten «Partizipations-Projekts» vorstellte: Vom 1. bis 3. November soll unter dem Titel «Rendez-vous» im Volkshaus eine Ausstellung mit begleitenden Referaten und Workshops das «Zukunftsbild» aus dem Dialogprozess der «breiten Bevölkerung» präsentiert werden. So die kurze Info. Weshalb dieser Anlass mitten in der Woche stattfinden soll sowie ob und wie die Bevölkerung sich einbringen kann, konnte leider nicht diskutiert werden, weil dafür keine Zeit eingeplant wurde – und die Zeit ohnehin schon fortgeschritten war.
Auch auf andere Fragen gab es keine Antworten. So blieben die Behörden die bereits im Mai versprochenen Informationen darüber, welche Empfehlungen aus dem Dialogprozess ins Agglomerationsprogram eingeflossen sind, weiterhin schuldig. Über den aktuellen Stand der Diskussionen rund um den Porttunnel war nichts zu erfahren. Betreffend «langfristiger Lösung» wurde bekannt gegeben, dass eine Machbarkeitsstudie zum Juratunnel in Auftrag gegeben werden solle – etwa betreffend die Geologie. Der Kritik, dass in einem ersten Schritt nun die kurz- und mittelfristigen Massnahmen umzusetzen und deren Wirkung abzuwarten seien, bevor Geld für die «langfristige Lösung» ausgegeben werde, hielt Sandra Hess entgegen, man müsse «auf allen drei Ebenen» gleichzeitig arbeiten.
Wie sich die vorgelegte Auslegeordnung für die Umsetzung der Empfehlungen in der Praxis bewähren wird, muss sich erst noch zeigen. Die Organisation, auch dies wurde gestern Abend mehrmals betont, sei vorläufig noch im Aufbau begriffen und werde erst im Juni 2022 richtig Fahrt aufnehmen können.
Wichtig wäre allerdings, dass sich die Reflexionsgruppe genau jetzt mit Inputs und Beratung einbringen könnte. Damit die Fahrt dann auch in die richtige Richtung geht. – Das dürfte schwierig werden: Die nächste Reflexionsgruppen-Sitzung soll erst am 6. Dezember stattfinden.
PS: Eigentlich waren die Medien zu später Stunde (für 21.45 Uhr) noch zu einem Point de Presse eingeladen. Nachdem keine MedienvertreterInnen erschienen sind, wurde nach kurzem Hin und Her darauf verzichtet, eine gemeinsame Medienerklärung zu erstellen. In diesem Fall, forderte Erich Fehr, dürften sich weder Behörden noch Sitzungsteilnehmende im Nachhinein gegenüber den Medien zum Abend äussern. Eine Forderung, die ebenfalls an die Ära Stöckli erinnert…
CORONA VERÄNDERT
VERKEHRSFLÜSSE
Längst ist die Corona-Ruhe auf den Schweizer Strassen Geschichte. Im Frühjahr 2020, als die Menschen hierzulande ihre Mobilität auf ein Minimum reduzierten, waren Züge und Busse halb leer – und die Strassen zeitweise wie ausgestorben.
Heute ist der Verkehr wieder zurück auf den Strassen. Trotzdem hat sich einiges verändert, wie das Regionaljournal Bern Fribourg Wallis letzte Woche berichtete: «Die Verkehrsspitzen im Morgen- und Abenderkehr sind abgeflacht», stellte Mark Siegenthaler vom Bundesamt für Strassen Astra fest.
Das Astra hat in den vergangenen Monaten Verkehrsdaten von vier stark befahrenen Autobahnen im Kanton Bern ausgewertet. Die Resultate dieser Studie sind nicht nur bemerkenswert, sie decken sich auch mit Beobachtungen auf den Berner Kantonsstrassen, wie das Berner Tiefbauamt gegenüber dem Regionaljournal bestätigte.
Weil die Arbeitszeiten seit Corona offenbar flexibler gehandhabt werden, verteilt sich das Verkehrsaufkommen besser über den Tag. Eigentlich eine gute Nachricht, denn das heisst, dass der Verkehr besser fliesst, ohne dass sogenannte Engpässe weiter ausgebaut werden müssen.
Davon will man beim Kanton Bern aber offenbar (bis jetzt) nichts wissen. Der Leiter des Tiefbauamts Stefan Studer stellte gegenüber dem Regionaljournal klar: « Wir gehen nach wie vor von einem Bevölkerungswachstum und einer steigenden Konjunktur aus» – was bedeute, dass es auch mehr Verkehr geben werde. Deshalb, so Studer, halte man an den langfristigen Verkehrsprojekten fest.
Dabei müsste man zwingend neu über die Bücher: Früher sei die Errechnung der Verkehrsströme einigermassen simpel gewesen, so Astra-Fachmann Mark Siegenthaler gegenüber dem Regionaljournal. Bevölkerungszunahme und Konjunktur hätten jedes Jahr rund ein Prozent mehr Verkehr auf die Strassen gebracht. Diese Berechnung funktioniere momentan nicht mehr: «Die Karten sind neu gemischt. Niemand weiss, wie sich das mit dem Homeoffice genau weiterentwickelt und wann die Leute wieder im früheren Rahmen den ÖV benützen.»
Diese Message ist offenbar im Berner Tiefbauamt immer noch nicht angekommen. Wie lange kann und will man sich dort noch den aktuellen Herausforderungen verschliessen?
Als Nachhilfe- und Pflichtlektüre sei allen Verkehrsplanenden und PolitikerInnen das Interview mit Verkehrsexperte Andreas Sauter-Servaes im Bieler Tagblatt vom 23. August empfohlen:
REFLEXIONSGRUPPE
ZUM ZWEITEN
Über drei Monate sind es her, seit «Espace Biel/Bienne.Nidau», die Nachfolgeorganisation des Runden Tischs, die ehemaligen Teilnehmenden des Dialogprozesses zu einem ersten Austausch einlud.
Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr und seine Nidauer Amtskollegin Sandra Hess informierten damals als Co-Präsidierende der neuen Organisation kurz und sehr allgemein darüber, was in den Monaten seit dem Abschluss des Dialogs weiter gelaufen sei – und wie es laut ihren Vorstellungen nun weitergehen solle.
Für die anwesenden VertreterInnen der am Dialogprozess beteiligten Organisationen war die ihnen künftig zugedachte Rolle in der sogenannten Reflexionsgruppe von besonderem Interesse. Wie unabhängig und frei wird sie agieren können? Welches Gewicht werden ihre Einschätzungen haben? Wie transparent und partizipativ wird die künftige Entwicklung und Planung verlaufen?
Damals, am 10. Mai gab es nebst kritischen Tönen schliesslich auch viel Hoffnung. Hoffnung, dass die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess künftig im Austausch mit den Organisationen, welche diese formuliert und mitgetragen hatten, erfolgen würde. Die Rede war von verbesserter Transparenz, die Behördenmitglieder signalisierten Bereitschaft, sich auf eine Fortsetzung des Dialogs einzulassen.
Seither herrschte Funkstille. Kurz vor den Sommerferien wurde einzig das Datum für ein zweites Treffen der Espace-Leitung mit der Reflexionsgruppe für den 30. August angekündigt.
Darüber hinaus wartete man vergeblich auf die versprochene Information darüber, welche Empfehlungen aus dem Dialogprozess ins neue Agglomerationsprogramm eingeflossen sind. Ende Juli war dann einer Zeitungsnotiz zu entnehmen, dass dieses mittlerweile beschlossen und an die Bundesbehörden weitergeleitet worden seien.
Auch aus der Zeitung zu vernehmen war, Nidau wolle – wie mehrfach angekündigt und in den Empfehlungen des Dialogprozesses auch verankert – in Sachen Porttunnel vorwärts machen. In dieser Sache habe es auch bereits eine Reihe von Sitzungen gegeben, zitiert das Bieler Tagblatt die Antwort des Nidauer Gemeinderats auf einen parlamentarischen Vorstoss. Diesem ist auch zu entnehmen, dass «die Notwendigkeit sowie die ursprüngliche Linienführung des Porttunnels aus dem abgeschriebenen Projekt» nicht in allen Gemeinden unumstritten sei.
Anfang dieser Woche folgte dann endlich doch noch die Einladung mit Traktandenliste und Unterlagen. Diesen ist zu entnehmen, dass offenbar unter dem Titel «Rendez-vous» eine «erste breite Partizipation der ÜPO» (so lautet die Abkürzung der Espace-Organisation) geplant ist. Ferner sollen im Rahmen eines Workshops «die Eckpunkte des Entwurfs zur Organisation der Reflexionsgruppe» diskutiert werden. Geplant sind auch ein kurzer Exkurs zum Agglomerationsprogramm sowie Informationen über den aktuellen Stand der Arbeiten von Espace.
Ob angesichts des dicht bepackten Programms noch Zeit und Raum bleibt für Anregungen und Inputs von Seiten der Reflexionsgruppen-Mitglieder, bleibt jedoch offen.
Man darf gespannt sein!
ES GEHT WEITER!
Die Würfel sind gefallen: Das Komitee «Westast so nicht!» macht weiter. – Seit dem 10. August 2021 hat es einen neuen Vorstand! Dieser präsentierte sich nach einer sachlichen und engagierten Mitgliederversammlung en bloc und wurde mit 77 Stimmen – bei 7 Enthaltungen und 4 Gegenstimmen – mit überwältigendem Mehr und grossem Applaus gewählt.
Doch der Reihe nach: An der Mitgliederversammlung im Farelsaal wurde schnell klar: Die meisten der 89 Anwesenden bedauerten die vom Vorstand beantragte Auflösung des Vereins und hofften darauf, dass es weitergeht.
Gleich zu Beginn wurde einstimmig beschlossen, die Traktandenliste dahingehend abzuändern, dass vor den Wahlen eine ausführliche Information zum aktuellen Stand der Dinge sowie eine Diskussion über das Wie-Weiter stattfinden solle.
Nachdem die ordentlichen Geschäfte abgewickelt waren, ging es zur Sache. Noch-Vorstandsmitglied Urs Scheuss informierte über die aus seiner Sicht erfreulichen Entwicklungen seit dem Ende des Dialogprozesses. Sein Fazit: Das Komitee brauche es nicht mehr, eine Neuausrichtung oder Weiterentwicklung würde zuviel Zeit und Energie kosten.
Eine Argumentationslinie, der die Mehrheit im Saal nicht folgen mochte. Man zeigte zwar grosses Verständnis für die «Amtsmüdigkeit» der Vorstandsmitglieder, die in den letzten Jahren grosse und auch grossartige Arbeit geleistet hätten. Trotzdem war man sich (fast) einig, dass es weitergehen muss. Die meistgenannten Gründe:
- Die Auflösung des Komitees hätte zur Folge, dass die wichtigste Vertretung der BürgerInnenbewegung von den künftigen Diskussionen über die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Dialogprozess ausgeschlossen wäre.
- Die Auflösung wäre ein falsches Signal an die Behörden und AutobahnbefürworterInnen.
- «Nach dem Westast ist vor dem Westast» – die innerstädtische Autobahn ist trotz Abschreibung des Ausführungsprojekts längst nicht vom Tisch. Stichworte dazu sind: Juratunnel, unterirdische Anschlüsse in der Seevorstadt…
- In Biel und der gesamten Region ist viel in Bewegung – mit dem Dialogprozess haben sich die Behörden erstmals auf eine Partizipation der Bürgerinnen und Bürger auf «Augenhöhe» eingelassen – dies ist eine Chance, auch für andere und künftige Projekte und darf nicht ohne Not wieder preisgegeben werden – im Gegenteil.
- Es braucht eine starke BürgerInnenlobby für eine klimabewusste, zukunftsfähige Mobilitäts- und Regionalentwicklung.
Nach einer Reihe engagierter Voten, unter anderen von alten Kämpfern wie Kurt Rohner oder Hans Müller, die noch einmal betonten, wie wichtig diese BürgerInnenorganisation sei, und dass man sie nicht leichtfertig preisgeben dürfe, verlas Catherine Duttweiler noch eine Mail von Martin Gysel, dem Tunnelbau-Ingenieur, der das «Alternativprojekt Westast-so-besser» mit seinem Know-how ermöglicht hatte. Auch er plädierte eindringlich für das Weiterbestehen des Vereins weil er glaube, dass «das Ziel der Bürgerbewegung nicht erreicht ist.»
Schliesslich ergriff Titus Sprenger – langjähriges Basismitglied und Bieler Stadtrat – das Wort und fasste noch einmal zusammen, weshalb der Fortbestand und die Weiterentwicklung des Komitees so wichtig seien. Am Ende seines Votums präsentierte er die Namen der sechs Personen, die sich als neuer Vorstand für die Kontinuität des Engagements und die Zukunft des Vereins einsetzen wollen: Michael Clerc, Sascha Weibel, Catherine Duttweiler, Titus Sprenger, Alfred Steinmann (v.l.n.r) und Hervé Roquet.
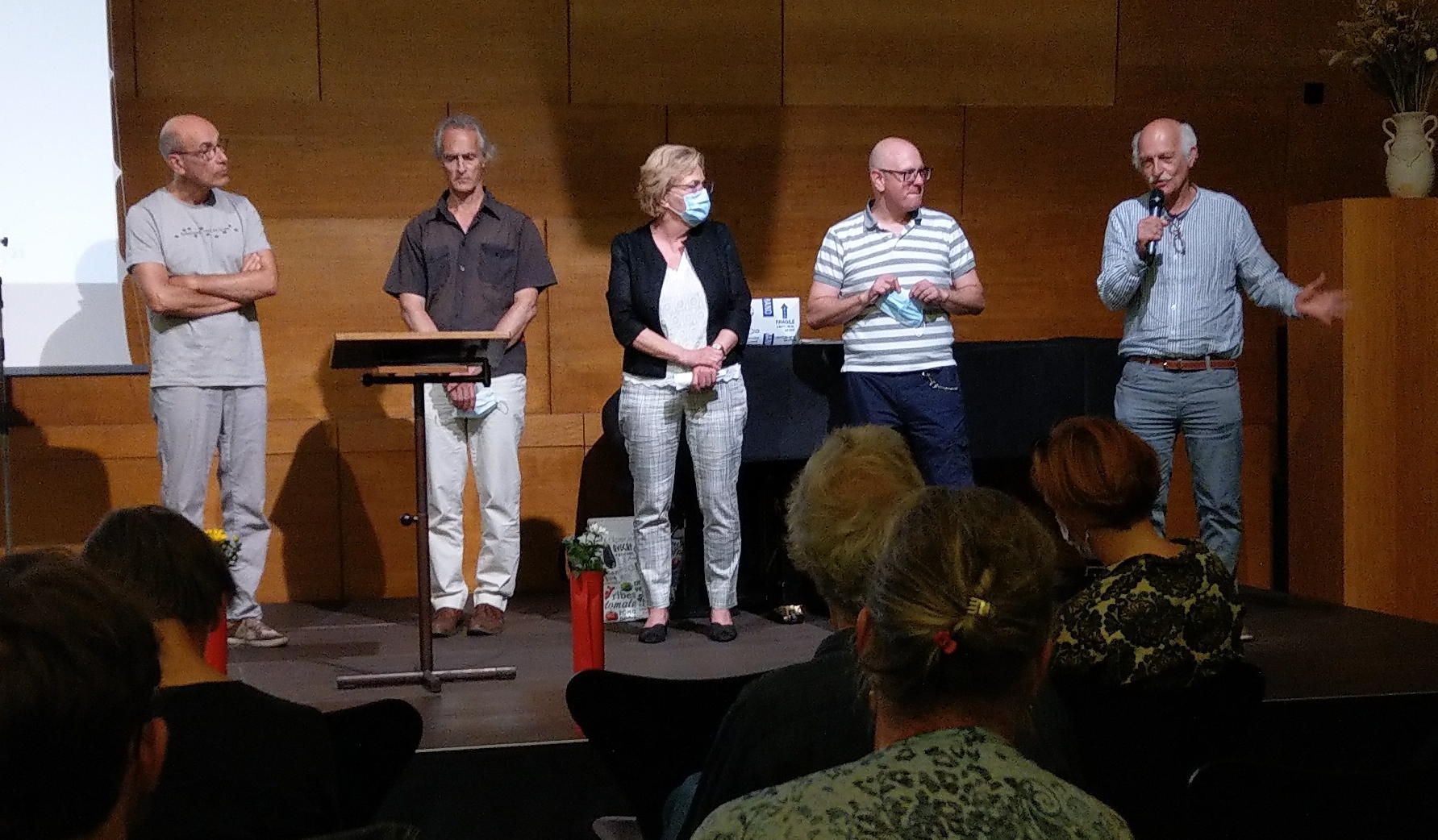
Hervé Roquet, Geograf und Urbanitätsforscher, war nicht anwesend, weil er beruflich im Ausland weilte, die anderen fünf neuen Vorstandsmitglieder stellten sich in kurzen Voten der Versammlung vor.
Sie erklärten, sich baldmöglichst an die Arbeit zu machen und luden alle Komitee-Mitglieder dazu ein, mitzudenken, mitzudiskutieren – sich einzubringen. In der Folge wurden sie fast einstimmig und mit viel Applaus gewählt.
Beim anschliessenden Bier im Farel-Hof war die Freude und Erleichterung der Mitglieder rundum spür- und hörbar. Einige bekannten sich dazu, nicht selber in einem Vorstand mitwirken zu wollen – trotzdem hätten sie es falsch und schade gefunden, wenn der Verein liquidiert worden wäre. Viele zeigten sich denn auch offen und bereit, sich künftig im Rahmen von Arbeitsgruppen zu engagieren – und selbstverständlich – wenn nötig, erneut die Stärken einer BürgerInnenbewegung auch auf die Strasse zu tragen.
JURATUNNEL –
SCHWARZ AUF WEISS
Ende Juli liess eine klitzekleine Notiz im Bieler Tagblatt aufhorchen. Dieser war zu entnehmen, dass der Verein Seeland.Biel/Bienne das Agglomerationsprogramm Biel/Lyss der vierten Generation (AP4) einstimmig beschlossen habe.
Dabei handelt es sich um jenes Programm, für das die Behörden laut eigenen Angaben die Empfehlungen aus dem Westast-Dialog auf deren Eignung zur Finanzierung über das AP4 abgeklopft hatten. In aller Eile und ohne breite Partizipation, weil – so hiess es im Frühjahr – das AP4 am 15. Juni beim Bund eingereicht werden müsse.
Gross deshalb das Erstaunen darüber, dass die betroffenen Gemeinden das Programm erst jetzt beschlossen haben sollen. Ein Blick auf die entsprechende Website des Bundesamts für Raumentwicklung schafft Klärung: Offenbar konnte die Abgabe für Biel/Lyss von der ersten in die zweite Tranche verschoben werden, deren Abgabe erst Mitte September fällig ist.
Leider hatte man offenbar vergessen, diesen Umstand den Mitgliedern der Reflexionsgruppe von Espace Biel/Bienne.Nidau mitzuteilen. Genauso, wie die Öffentlichkeit bis heute vergeblich auf die versprochenen konkreten Angaben darüber wartet, welche Empfehlungen aus dem Dialogprozess ins AP4 eingeflossen sind.
Immerhin ist das Programm nun aber öffentlich, so dass sich jeder und jede selber ein Bild darüber machen kann, ob und wie die Resultate des Runden Tischs im Agglomerationsprogramm Eingang gefunden haben.
Klar wird bei der Lektüre, dass die definitive Abschreibung des Westast-Ausführungsprojekts keine grundsätzliche Neuausrichtung der Verkehrsplanung oder Mobilitätsphilosophie in der Region zur Folge hatte. Im Gegenteil: Während Pläne und Vorhaben in Bezug auf innovative Mobilitätsentwicklungen fehlen oder vague bleiben, wird in der Siedlungsentwicklung an einem fast atemberaubenden Wachstumsszenario festgehalten.
Und: Während in den Empfehlungen aus dem Westast-Dialog für die langfristige Verkehrsplanung einzig festgehalten wird, dass die Schliessung der «Lücke im Natonalstrassennetz» angestrebt werden soll, steht im AP4 bereits schwarz auf weiss, dass dies mittels eines Juratunnels geschehen soll.
In Bezug auf die mittel- und langfristige Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur ist auf S. 71 des 135 Seiten dicken Dokuments etwa festgehalten:
- Das Regiotram zwischen dem rechten Bielerseeufer und dem Entwicklungsschwerpunkt Bözingenfeld ist im Zukunftsbild nicht mehr enthalten. Das Projekt wurde 2015 sistiert und wird bis 2040 nicht realisiert. Die Agglomeration fokussiert auf den Ausbau und die Optimierung des Bahn- und Busangebots. Als Grundlage dient das ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung, das bis 2022 erarbeitet wird. Darin wird auch geklärt, welche Rolle das Regiotram allenfalls als langfristige Option spielen kann.
- Der A5 Westast und die Umfahrung Vingelz sind im Zukunftsbild nicht mehr enthalten. Die A5 Westumfahrung Biel wird nicht in der geplanten Form realisiert. Stattdessen werden kurz- und mittelfristige Massnahmen zur verträglichen Abwicklung des Verkehrs auf dem bestehenden Strassennetz umgesetzt. Trotz Verzicht auf den Westast soll die Lücke im Nationalstrassennetz der A5 langfristig geschlossen werden. Im Vordergrund steht ein Juratunnel nördlich von Biel. Die Machbarkeit soll rasch abgeklärt werden, eine allfällige Realisierung erfolgt sicher nach 2040.
- Der Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel) wird im Zukunftsbild beibehalten. Der Nationalstrassenzubringer zur Entlastung von Nidau und Port soll realisiert werden. Die Realisierung bis 2040 ist möglich, erfordert aber rasch ein neues Ausführungsprojekt und ein neues Genehmigungsverfahren.
Dies ist nur ein Beispiel von zahlreichen Anhaltspunkten dafür, dass auch im AP4 Biel/Lyss weiterhin Wachstums- und Betondenken vorherrschen.
Alle Interessierten, die sich nicht durch das ganze umfassende Material hindurchkämpfen können oder wollen, finden HIER eine Zusammenstellung der aus unserer Sicht relevantesten Punkte.
FUNKSTILLE BEI ESPACE BIEL/BIENNE.NIDAU und GEMEINDE-INITIATIVE IN TWANN-TÜSCHERZ
Ein Hauch von Hoffnung wehte am Abend des 10. Mai durch den Stadtratssaal in Biel. Anlässlich des Austauschs zwischen VertreterInnen des Dialgoprozesses und «Espace Biel/Bienne.Nidau» hatte der Bieler Stadtpräsident und Co-Leiter der neuen Organisation Erich Fehr in schönen Worten Transparenz und Partizipation versprochen.
Insbesondere stellte er in Aussicht, dass die interessierte Bevölkerung bald erfahren werde, welche Empfehlungen aus dem Dialogprozess in die Projektanträge für das Agglomerationsprogramm beim Bund eingeflossen sind. Das war vor über einem Monat. Seither herrscht Funkstille.
Zur Erinnerung: Nach Abschluss des Dialogprozesses haben die Behörden in einem ersten Schritt jene Empfehlungen herausgefiltert, die eine Chance haben, im Rahmen des Agglomerationsprogramms aus der Bundeskasse finanziert zu werden. Um welche Empfehlungen es sich dabei handelt, wurde bisher nicht kommuniziert. Diese Woche müssen die Anträge nun eingereicht werden – Abgabetermin ist der 15. Juni 2021. Von Transparenz in dieser Sache bisher keine Spur…
Auch sonst hüllt sich Espace in Schweigen. Noch immer warten wir auf das bereinigte Protokoll des Austauschs vom 10. Mai. Wichtiger noch: Erich Fehr hatte damals in Aussicht gestellt, das nächste Treffen solle möglichst noch vor den Sommerferien – allenfalls kurz danach – stattfinden. Terminvorschläge sind bisher keine eingetroffen…

Dafür bewegt sich einiges in Twann-Tüscherz: Nach der abschlägigen und aus Sicht der Betroffenen unhaltbaren Antwort von UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga auf die Petition vom letzten Herbst, lancierte der Verein «N5 Bielersee – so nicht!» anlässlich seiner Jahresversammlung letzte Woche eine Gemeinde-Initiative. Darin fordern die InitiantInnen, dass sich der Gemeinderat im Rahmen der Organisation Espace Biel/Bienne.Nidau für eine nachhaltige Mobilitätslösung in der Region einsetzt (was bisher nicht der Fall ist) und sich für eine durchgehendeTempobeschränkung auf 60 km/h sowie für ein Transitverbot für den Schwerverkehr zwischen Biel und La Neuveville engagiert.
In einer ersten Reaktion erklärte Gemeindepräsidentin Margrit Bohnenblust gegenüber dem Bieler Tagblatt, ein Tempolimit und ein Verbot des Schwerverkehrs würden in der Kompetenz des Bundesamts für Verkehr liegen und seien aus ihrer Sicht deshalb nicht umsetzbar.
Fakt ist: Die Forderung nach einem Schwerverkehr-Transitverbot steht auch in den Empfehlungen aus dem Dialogprozess. Anlässlich des Austauschs vom 10. Mai hatte auch der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr erklärt, man wisse nicht genau, wie mit dieser Forderung umgehen.…
Liebe Politikerinnen und Politiker der Region! Es ist an der Zeit, dass ihr endlich aufwacht, euren Job macht und euch für die Anliegen eurer Bürgerinnen und Bürger einsetzt! Wenn die Stadt Biel, gemeinsam mit Twann und weiteren VertreterInnen der Region sich vehement für die von der Bevölkerung geforderten Massnahmen einsetzt, dürften sowohl das Tempolimit wie das Transitverbot umsetzbar sein…
AKTIV MITGESTALTEN
In Biel bewegt sich so einiges. Dies war am Samstag, 29. Mai 2021 anlässlich der Infoveranstaltung auf dem ehemaligen Schlachthofareal für alle Teilnehmenden wunderbar spür- und greifbar: Die Bevölkerung kam in Scharen und nutzte das Angebot, das lange Zeit als Unort bezeichnete und zum Abriss verurteilte historische Gelände zu besichtigen und sich inspirieren zu lassen.

Unter den über 400 Besucherinnen und Besuchern, die der Einladung der IG Schlachthof-Kulturzentrum gefolgt sind, waren auch zahlreiche alte Bekannte aus der Westast-so-nicht-Bewegung zu entdecken. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass das nunmehr westastbefreite Areal vielleicht schon bald unter Denkmalschutz gestellt und zu einem öffentlichen Begegnungsort weiter entwickelt werden kann.
Die BürgerInnenbewegung in der Region Biel hat viele bewegt – und viel in Bewegung gebracht. Dazu gehören nebst dem Komitee «Westast so nicht» mit seinen über 2000 Mitgliedern etwa auch die Vereine wie Stopp-Agglolac, Kulturschutzgebiet oder das EnsembleStark.
Nachdem die beiden stadtzerstörerischen Grossprojekte Westast-Autobahn und Agglolac erfolgreich verhindert werden konnten, bietet sich nun die einmalige Chance für die Bevölkerung, ihre Ideen und Visionen für die Entwicklung der Region aktiv einzubringen. Wie dies am Samstag auf dem Schlachthofareal der Fall war.
Unter dem Titel «Weiterhin aktiv mitspielen» geht der Architekt und Raumplaner Kurt Rohner in seinem heutigen Leserbrief im Bieler Tagblatt mit den Auflösungs-Absichten des Komitee-Vorstands von «Westast-so-nicht» denn auch hart ins Gericht: «Da haben wir es in unserer Region fertiggebracht innerhalb von wenigen Jahren einen Verein mit über 2000 Mitgliedern und zusätzlichen Sympathisanten aufzubauen und aktiv ins Politwirrwarr einzugreifen, und nun will man dieses Potenzial einfach versanden lassen, weil man in den Statuten keinen Auftrag mehr habe und weil die Freiwilligenarbeit an Grenzen gerate.» Sein Urteil: «Sowas von ‹bireweich› (…) Man muss in dieser für unsere Region fundamentalen Planung weiter aktiv mitspielen. 1000 bis 2000 Bürgerinnen und Bürger sind politisch ein Gewicht und sollten es bleiben. Danke für die Rettung eines grossartigen Vereins, den wir dringend weiter brauchen.»
Wie hat doch Julian Meiner von der IG Schlachthof-Kulturzentrum im Bieler Tagblatt vom 29. Mai so schön gesagt: «Stadtentwicklung geschieht heute partizipativ.»
«WIR NEHMEN DIE
EINLADUNG AN ZUM DIALOG…»
Beim Computer aufräumen poppt plötzlich das Video auf. Es datiert vom 31. August 2018 – aufgenommen vor dem Kongresshaus in Biel. Erinnerungen werden wach…
.…es war der Anfang eines Dialogs. Gut zwei Jahre später hat die Bevölkerung der Region geschafft, woran lange niemand glaubte: Der Westast ist Geschichte. Das Engagement für die Stadt und die Region geht weiter.
«Wir arbeiten mit der Realität, die wir jetzt haben, mit den heutigen Bedingungen», erklärte eine junge Frau damals dem kantonalen Baudirektor. Zahlreiche Menschen waren gekommen, um das vom Kanton allzu lang verweigerte Gespräch endlich aufzunehmen. «Wir wollen nicht, dass unsere Stadt kaputt geht» lautete damals der Grundtenor.
Nachdem die Bevölkerung die Zerstörung abwenden konnte, geht es heute darum, den Faden für eine gute Entwicklung gemeinsam weiter zu spinnen… Die Menschen in der Region sind engagiert unterwegs, wie zahlreiche Beispiele von der Diskussion um Agglolac über die «Rettung» des Grünraums am Passarellenweg bis zum «Kulturraum Schlachthof» zeigen.
DANKE, ERNA!

Das Bieler Tagblatt widmet in der Samstagsausgabe vom 23.01.2021 eine Seite der «Aufbruchstimmung» im westastbefreiten Gurnigelquartier. Zu Wort kommt darin eine unermüdliche Kämpferin der ersten Stunde: Erna Müller war im Herbst 2007 eine der Mitinitiantinnen des im Februar 2008 gegründeten Vereins LQV – jenem Verein, der sich schon hartnäckig gegen die offene Autobahnschneise mitten durch die Stadt wehrte, als andere Organisationen und Parteien noch meinten, man könnte diesbezüglich eine «Optimierung» erhandeln.
Unermüdlich hat Erna, die seit vierzig Jahren in einer kleinen, gemütlichen Mietwohnung an der Gurnigelstrasse daheim ist, ihre Nachbarinnen und Nachbarn dazu ermutigt, im Widerstand gegen das Autobahnprojekt ebenfalls aktiv zu werden. Das war nicht immer einfach. Manche haben sich nicht getraut, andere haben aufgeben, sind weggezogen, weil sie den Druck, die jahrzehntelange Unsicherheit nicht mehr ausgehalten haben.
Doch Erna hat an ihrer Vision festgehalten: Das Leben muss über den Beton siegen, lautet ihr Motto. Als dann 2015 das «Komitee Westast so nicht!» gegründet wurde, gehörte sie auch dort zu den ersten Vereinsmitgliedern. Sie war eine der ersten, die an ihrem rebenumrankten Balkon eine Stop-Westast-Blache montierte, sie hat Leute miteinander ins Gespräch gebracht, Netzwerke geknüpft und im Hintergrund unermüdlich Unterstützung geleistet.
So auch beim legendären Velo-Flashmob vom 20. Mai 2017, wo sie bei der Organisation beratend zur Seite stand und als Nicht-Velofahrerin die klingelnde Schar zusammen mit einer Freundin vom Strassenrand mit Transparent und Winken unterstützt und angefeuert hat.

Als im Sommer 2018 die Tavolata direkt vor ihrer Haustür stattfinden sollte, hat sie natürlich auch da von Anfang an tatkräftig mitgeholfen. Nicht nur am Tag selber gehörte sie zu den GastgeberInnen an der Gurnigelstrasse. Sie hat danach auch das von einer Gruppe StadtgärtnerInnen frisch gepflanzte Grün auf dem Parkplatz am Gurnigelkreisel bei Bedarf bewässert und mitgehegt und ‑gepflegt.
Erna war immer da. Immer voller Energie, Engagement, Ideen – Erna, du hast so viele an Bord geholt, davon überzeugt, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Du hast immer wieder Aktionen angeschoben, die Leute bei der Stange gehalten, zum Durchhalten animiert und dafür gesorgt, dass die Gurnigelstrasse zu einem lebendigen Ort des Widerstands wurde.
Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Bieler Tagblatt nun auch dir eine Stimme gegeben hat. Ohne Menschen wie dich, wären die Bagger wohl schon längst aufgefahren. Dank Menschen wie dir, ist und bleibt die Stadt ein menschlicher, lebenswerter Ort. Ich weiss, dass du auch weiterhin dafür sorgen willst, dass sich die Menschen im Gurnigel- und Mühlefeld begegnen und vernetzen. Damit es gut kommt, mit dieser neuen «Aufbruchstimmung». Danke.

ANRECHT AUF ENTSCHÄDIGUNG?
Mittlerweile dürften alle rund 650 Einsprecherinnen und Einsprecher gegen das Westastprojekt die Verfügung des UVEK vom 15. Januar 2021 erhalten, und damit steht schwarz auf weiss fest, dass dieser Albtraum für Biel vorbei ist (Einsprachefrist bis am 15.2.2021).
Besonders betroffen sind all jene MieterInnen und EigentümerInnen, deren Liegenschaften der Westast-Schneise zum Opfer gefallen wären. Sie litten nicht erst seit der Verfügung des Enteignungsbanns durch die Bundesbehörden im Frühjahr 2017. Schon lange zuvor hing das Damoklesschwert der Westastplanung über diesen Quartieren, weil die früheren Stadtregierungen die A5-Autobahn unbedingt mitten durch die Stadt ziehen wollten. Die EigentümerInnen durften nur noch die allernötigsten Unterhalts-Investitionen in die Häuser tätigen. Viele BewohnerInnen sind weggezogen, weil sie den stetigen Druck und die andauernde Unsicherheit nicht mehr ausgehalten haben.
Besonders betroffen ist unter vielen andern auch der Eigentümer des Grundstücks an der Alfred-Aebi-Strasse 47 bis 51: Er hatte das Areal der ehemaligen Wirtschaft Schönegg vor rund 20 Jahren gekauft, um hier als Altersvorsorge ein Bürogebäude und zwei Mehrfamilienhäuser zu bauen. Die Tiefgarage war bereits fertiggestellt, als der Baustopp kam. Weil die offene Westast-Schneise das Grundstück tangiert hätte… Seither wuchert die Natur auf der Brache am Gurnigelkreisel. Ohne Verschulden des Eigentümers. Sondern als Folge des behördlich verordneten Baustopps und Enteignungsbanns.

Kann der Eigentümer nun – mit über 15 Jahren Verspätung – seine einstigen Pläne umsetzen? – Vermutlich müsste er einige Anpassungen vornehmen. Zudem käme der Bau heute wohl wesentlich teurer zu stehen als damals… Kann er dafür eine Entschädigung einfordern? Wie steht es um den Schadenersatz für die entgangenen Miet-Einnahmen der letzten 15 Jahre?
Solche Fragen stellen sich viele Menschen in den westastbefreiten Quartieren. Die geplanten Investitionen, die untersagt waren, müssen nachgeholt werden. Die Verfügung sagt nichts über eine Entschädigung für die durch die Westast-Blockade erlittenen Einbussen und Schäden der letzten Jahre.
Vermutlich müssen sie auch dafür wieder kämpfen. Im Bundesgesetz über die Enteignung steht unter dem Titel «Enteignungsbann» klipp und klar:
«Für den aus dem Enteignungsbann entstehenden Schaden hat der Enteigner vollen Ersatz zu leisten.»
03/03/2021
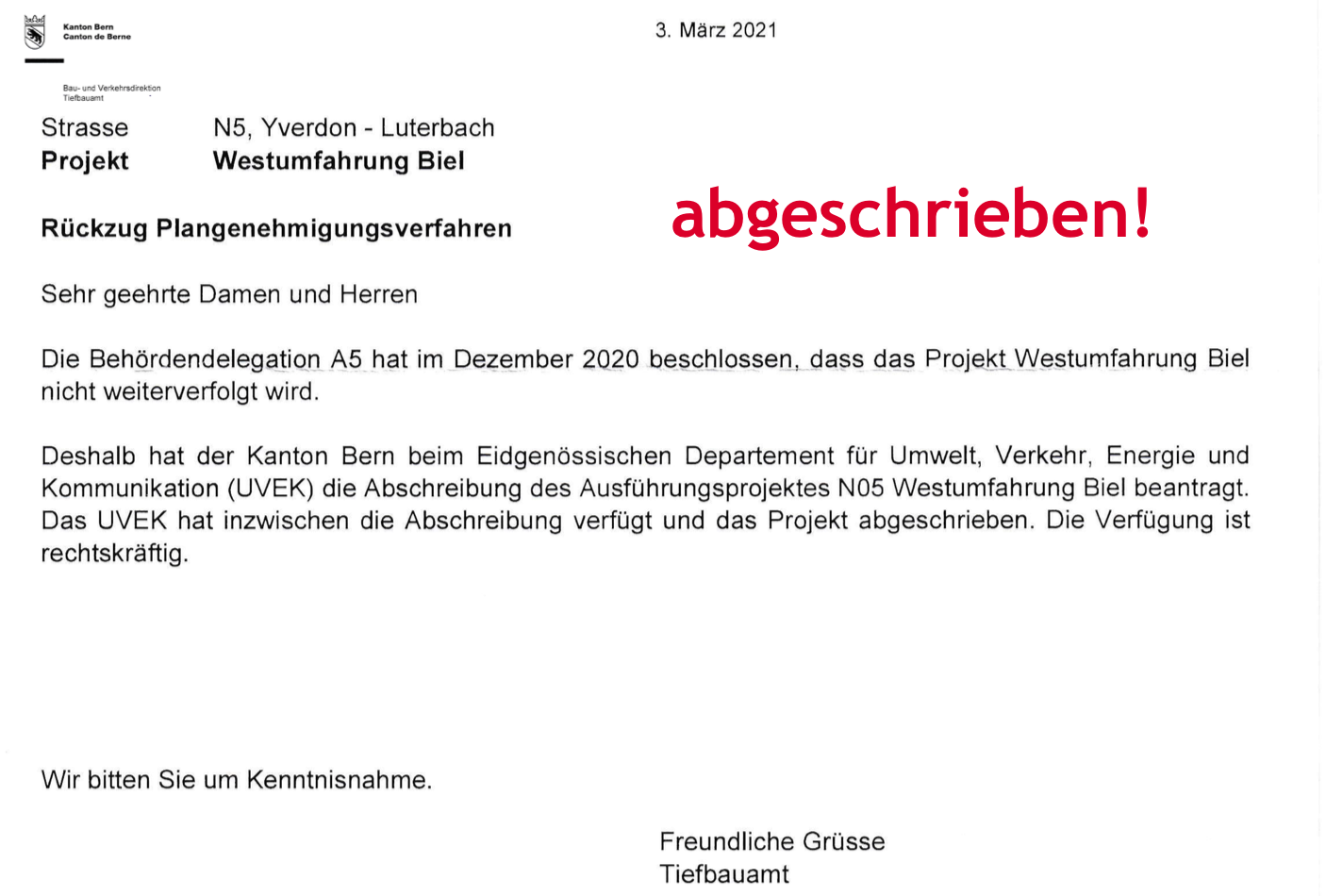
AUSFÜHRUNGSPROJEKT ABGESCHRIEBEN!
Laut einer Medienmitteilung des Kantons Bern vom 16. Januar 2021 hat das Departement für Umwelt Energie, Verkehr und Kommunikation UVEK mittlerweile die vom Kanton beantragte Abschreibung des Ausführungsprojekts für die A5-Westumfahrung Biel/Bienne verfügt.
Allerdings kann in den kommenden 30 Tagen gegen die Abschreibung noch Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden – erst danach sei sie rechtskräftig, schreibt der Kanton weiter.
Trotzdem haben die ersten Betroffenen, die sich 2017 mit einer Einsprache gegen den Westast gewehrt hatten, vom UVEK die lange erhoffte Verfügung erhalten:
Nun ist der Enteignungsbann also von offizieller Seite aufgehoben! Für die Menschen in den westastbefreiten Quartieren beginnt damit ein neues, hoffentlich erfreulicheres Kapitel…
WESTASTBEFREIT – UND JETZT?

Die Empfehlungen aus dem Westast-Dialog schwurbeln in Sachen Enteignungsbann, dass dieser aufgehoben und ersetzt werden müsse «durch eine Zone mit Planungspflicht und anschliessend durch griffige interkommunale Instrumente mit Zukunftspotenzial für die Stadtentwicklung.»
Was die Stadtbehörden von Nidau und Biel in der Vergangenheit unter Stadtentwicklung mit Zukunftspotenzial verstanden haben, lässt Böses erahnen: Noch während des Dialogprozesses, als eine Realisierung des Autobahnanschlusses Bienne Centre schon sehr unwahrscheinlich war, hat man in Nidau die Aufzonung des historischen Gurnigelquartiers weiter vorangetrieben: Künftig sollte dort, wo die Westastschneise geplant war sechsstöckig bis zu 23 Meter hoch gebaut werden können…

Zur Erinnerung: Die städtebauliche Begleitplanung von 2017 hatte entlang der geplanten Westast-Schneisen im Bahnhofsquartier Hochhäuser vorgeschlagen – quasi als rentable Lärmschutzwände… Diese Planung wurde anlässlich des Dialogprozesses vom Städtebauexperten Han van de Wetering, scharf kritisiert. Er forderte vielmehr, dass dieses historisch gewachsene Stück Stadt mit dem Verzicht auf den Westast «aus dem Bestand heraus» weiter zu entwickeln sei.
Wie auch immer: In der Stadt Biel sind aktuell sämtliche Parzellen, die von der Westast-Planung betroffen waren, als «Zonen mit Planungspflicht» ausgewiesen. Was wird sich für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer hier in nächster Zeit ändern?
Ein Grossteil der betroffenen Liegenschaften – so etwa auch der Schlachthof – befindet sich im Besitz der Stadt oder des Kantons. Hier hat die öffentliche Hand also die Möglichkeit – und unseres Erachtens auch die Pflicht – die betroffene Bevölkerung, deren Lebensqualität während Jahrzehnten durch das Westast-Damoklesschwert beeinträchtigt war, bei der Neu-Entwicklung ihrer Umgebung zu berücksichtigen und sie daran zu beteiligen.
Was nicht geht, ist althergebrachte Planung und Stadtentwicklung über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Liegenschaften, welche der Kanton oder die Stadt im Hinblick auf den Westast günstig erworben haben, dürfen jetzt, wo ihr Wert dank Westast-Verhinderung wieder steigt, nicht an Investoren weiterverkauft werden, um ein bisschen Gewinn abzuschöpfen! Die Stadt gehört allen Bewohnerinnen und Bewohnern und nicht den Meistbietenden!
 © Anita Vozza
© Anita Vozza
GRUSS AUS WIEN
Zum Jahresauftakt erreicht uns eine ermunternde Nachricht mit einer spannenden News aus Wien: Hermann Knoflacher, der kreative Denker und Verkehrsexperte aus Österreich, der vor bald vier Jahren im Interview klar und deutlich gesagt hatte, was er von den Westast-Plänen hält, gratuliert uns per Mail zum «Teilerfolg» in Sachen Westast:
Was das in der Mail erwähnte Waldviertel-Autobahnprojekt anbelangt: Am 22. Dezember gaben die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler und die zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekannt, dass dieses Projekt endgültig abgeblasen werde. Nach einer zweijährigen «ergebnisoffenen Prüfung» gab man einem breit abgestützten, flächendeckenden und zukunftsfähigen Mobilitätspaket definitiv den Vorzug. Es wird deshalb in dieser Region keine weitere Autobahnplanungen mehr geben…
Laut dem ORF will die österreichische Bundesregierung bis 2035 insgesamt 1,8 Milliarden Euro für das «Mobilitätspaket nördliches Niederösterreich» in die Hand nehmen – davon sollen 1,35 Milliarden in Bahnprojekte (Neu- und Ausbau) investiert werden.
Das ist eine klare Ansage: Statt weiterhin Millionen und Milliarden in die Planung umstrittener und zerstörerischer Autobahnen zu investieren, fliesst das Geld in Massnahmen zur Förderung einer zukunftstauglicheren Mobilität, die Umwelt- und Klima-verträglicher ist. – Ein toller Erfolg für die Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen die geplante Transitautobahn und für sinnvolle Alternativen engagiert haben!
WIR MACHEN WEITER!
Der A5-Westast ist gebodigt, zumindest in der bisherigen Form.
Entwicklungen, wie wir – die IG Häb Sorg zur Stadt – sie vor einem Jahr in unserem fiktiven «Jahresrückblick 2020» erträumt haben, liegen heute im Bereich des Möglichen: Dank Aufhebung des Enteignungsbanns können die erhaltenswerten Liegenschaften an der Gurnigelstrasse endlich saniert werden, das Wydenau-Quartier wird zu neuem Leben erweckt, Park and Ride-Angebote erleichtern PendlerInnen das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad – die Region entwickelt sich zu einem vorbildhaften Labor für nachhaltige Entwicklung.

Schöne Zukunftsaussichten! Die sich aber leider nicht von allein erfüllen. Jetzt erst recht braucht es weiterhin wache und kritische BürgerInnen, die mitreden und sich zur Verwirklichung dieser Visionen engagieren.
Die IG Häb Sorg zur Stadt hat deshalb beschlossen, auch im Neuen Jahr dranzubleiben. Wir setzen uns nach wie vor dafür ein, dass menschenfreundliche und von der lokalen Bevölkerung getragene Entwicklungen unsere Stadt und Region vorwärtsbringen.
Das heisst ganz konkret: Mit der Aufhebung des Enteignungsbanns dürfen die wertvollen Parzellen rund um den Bahnhof nicht zu einem Eldorado für Investoren verkommen, die nichts anderes im Sinn haben, als den plötzlich entstandenen Mehrwert auf dem Areal des ehemals geplanten Autobahnanschlusses Bienne Centre in die eigenen Taschen umzuleiten. Wir unterstützen deshalb die Stimmen, die fordern: Kultur statt Kommerz auf dem Schlachthofareal!

Zudem müssen sämtliche Alarmglocken geläutet werden gegen die vorschnelle Planung eines Juratunnels mit Autobahnanschluss in der Seevorstadt. Dagegen formiert sich bereits Widerstand. Klar, dass wir auch hier dabei sind.
Und weiter im Text: Die Umsetzung eines Transitverbots für Lastwagen vom Bözingenfeld entlang dem linken Bielerseeufer bis La Neuveville steht in den Empfehlungen des Westast-Deals, bestärkt wird diese Forderung zudem in einem offenen Brief an Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga – auch dieses Engagement kann auf unsere Unterstützung zählen…

Die Bevölkerung im Seeland weiss dank dem erfolgreichen Kampf gegen den Westast, dass sie ihr Lebensumfeld mitgestalten kann und will. Sie hat diese Lektion verstanden – im Gegensatz zu gewissen Investoren, Behörden und PolitikerInnen…
Die haben nämlich noch ein weiteres Projekt, das sie gegen den Willen breiter Bevölkerungskreise durchdrücken wollen. Beweis: Die «Spezialausgabe» von BIEL BIENNE in der Altjahreswoche – der «grössten Zeitung der Region», wie sie sich selber preist. «Agglolac» steht in grossen Lettern auf der Frontseite des Gratis-Wochenblatts, das in alle Briefkästen der Region verteilt wird. Kurzum: In der Altjahreswoche bessert Verleger Cortesi seine Bilanz mit einer gigantischen Publi-Reportage (Neudeutsch für Reklame) auf. Die ganze Zeitung ist ein einziger Werbespot für das umstrittene Mobimo-Immobilienprojekt.
Eigentlich hätte der Entscheid, ob die Überbauung des ehemaligen Expo-Geländes am See überhaupt eine Mehrheit in der Bevölkerung findet, bereits dieses Jahr fallen sollen. Infolge Corona wurde er jedoch verschoben. Laut aktuellem Stand wird das Projekt nun im nächsten März den Stadtparlamenten von Nidau und Biel vorgelegt und im Juni 2021 den Stimmberechtigten der beiden Städte.
Was die börsenkotierte Immobiliengeldmaschine Mobimo dem alten Fuchs Cortesi für die vorgezogene Abstimmungspropaganda auf den Tisch geblättert hat, bleibt das Geheimnis der Vertragspartner. Ebenso die Summe, die «Stadtwanderer» Benedikt Loderer für seine Kolumne kassiert hat, in der er sich in gewohnt kapriziöser Manier vor den Karren für ein JA zur Agglolac Vorlage spannen lässt. Dies, obschon der unermüdliche Polemiker für die Grünen im Bieler Stadtrat sitzt, die Agglolac ablehnen. Als Mitglied der Planer- und Architektengilde will er die Gefolgsleute in seiner Cloud wohl nicht vor den Kopf stossen.
Nebst Loderer kommen im Agglolac-Werbeblatt weitere alte Bekannte zu Wort: Auf der Frontseite lacht uns nicht nur der Mobimo-Boss entgegen, auch der bald 70jährige Ex-Stadtpräsident und Westastturbo Hans Stöckli und die aktuellen Stadtoberen von Biel und Nidau werben erneut für ein Beton-Bauprojekt als «grosse Chance für die gesamte Region».
Über 15 Seiten haben die «Journalistinnen und Journalisten» von BIEL BIENNE mit Agglolac-Promo gefüllt. Pro forma lässt man natürlich auch die KritikerInnen zu Wort kommen: Zwei von ihnen dürfen sich auf einer Seite äussern – der Rest ist pure Werbung für die schöne neue Agglolac-Welt.
Was man davon zu halten hat, wissen die Menschen in Biel und Nidau mittlerweile bestens: Auch den Westast versuchte man ihnen mit beschönigenden Visualisierungen zu verkaufen. Notabene hatte damals das gleiche «Büro für Öffentlichkeitsarbeit» die Finger im Spiel, das auch für die Promo des Immobilien-Monsters am See zuständig ist. Um was es bei Agglolac jedoch wirklich geht und was auf dem Spiel steht, erfährt man anderso – zum Beispiel auf der Website des Vereins Stopp-Agglolac.
SO (UN)KLUG ALS WIE ZUVOR?
«Jetzt ist es also auch amtlich: Die Behördendelegation will alle Empfehlungen aus dem Dialogprozess zum A5-Westast in Biel umsetzen», war im Bieler Tagblatt zu lesen.
Um es noch einmal zu betonen: Der Westast ist tot – das bisher sistierte Einspracheverfahren wird im Januar nicht wieder aufgenommen, das gestoppte Ausführungsprojekt ist definitiv Geschichte. Das ist gut – und vor allem den Menschen zu verdanken, die in den letzten Jahren hartnäckig und entschlossen gegen dieses aus der Zeit gefallene Projekt gekämpft haben.
Die Bürgerinnen und Bürger, die auf die Strasse gegangen sind, Mitwirkungs- und Einspracheeingaben geschrieben haben, Bäume markierten, Feste organisierten, Flyer verteilten und darüber nachdachten, wie und wohin sich ihre Stadt und Region entwickeln soll.

Hunderte, ja Tausende von Menschen hatten sich längst für eine bunte, lebensfrohe und zukunftstaugliche Stadt und Region entschieden, als sich die Behörden noch mit Vehemenz für den Autobahn-Westast einsetzten und sich der Bieler Stadtpräsident nicht zu schade war, die Westastgegnerschaft aufs härteste zu verurteilen und zuweilen gar persönlich zu diffamieren.
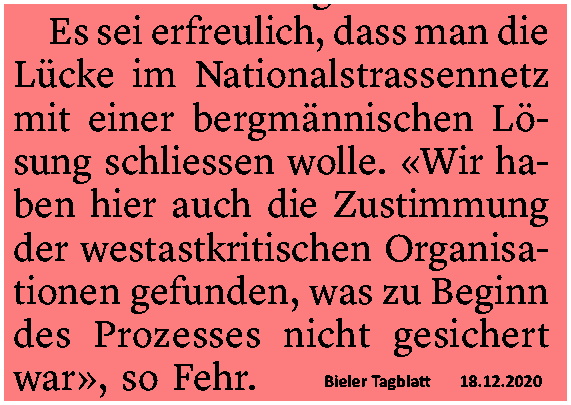 Und heute? Es ist noch keine vier Monate her, dass Stadtpräsident Fehr die Seiten gewechselt und sich dreist an die Spitze derjenigen gestellt hat, die den Westast für «politisch tot» erklärten. Damit hat es sich aber: Die herablassende Haltung der Behörden und Verbandsfunktionäre gegenüber der Bevölkerung ist – leider nicht nur bei Erich Fehr – die gleiche geblieben.
Und heute? Es ist noch keine vier Monate her, dass Stadtpräsident Fehr die Seiten gewechselt und sich dreist an die Spitze derjenigen gestellt hat, die den Westast für «politisch tot» erklärten. Damit hat es sich aber: Die herablassende Haltung der Behörden und Verbandsfunktionäre gegenüber der Bevölkerung ist – leider nicht nur bei Erich Fehr – die gleiche geblieben.
Jetzt, wo der Dialogprozess vorbei und überstanden ist, wollen die Behörden weitermachen wie bisher. Keiner hat es so klar und deutlich auf den Punkt gebracht, wie der Bieler Stadtpräsident: «Unsere Ambition ist es, mit der Partizipation einen Schritt weiterzugehen und die Leute zum Mitdenken zu animieren – deshalb der Begriff Reflexionsgruppe. Es ist aber auch immer klar, es kann nicht eine Partizipation von Tausenden von Leuten sein.…», erklärte er gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF.
In der sogenannten Reflexionsgruppe sollen daher jene Organisationen und Verbände Einsitz haben, die an der Ausarbeitung des «Kompromisses» beteiligt waren. Die Bevölkerung hingegen soll gefälligst schweigen und warten.
So etwa im Gurnigelquartier, wo die Menschen aufatmen und sich über die Aufhebung des Enteignungsbanns freuen könnten. Wenn sie sicher sein könnten, dass nun nicht wieder über ihre Köpfe hinweg geplant wird… Allerdings haben sie gestern – via Regionaljournal im Radio – erfahren, dass für ihr Quartier bereits grosse Veränderungen angedacht sind: In einem Nebensatz erwähnte Stadtpräsident Fehr, dass man eine Verlegung des «Täuffelenbähnlis» prüfe und in diesem Quartier künftig höher und dichter bauen wolle…
 © Anita Vozza
© Anita Vozza
Auch von den Nidauer Stadtoberen tönt es ähnlich. Es könne nicht sein, dass nun nochmal «20 Jahre nichts geht» , wird die Nidauer Stadtpräsidentin Sandra Hess heute schweizweit in den Medien zitiert. Wie Fehr gehört auch sie zu den Hauptverantwortlichen dafür, dass es so lange gedauert hat, bis man die Westast-Blockade nun endlich lösen konnte. Gleichzeitig stellen die Behörden aber munter die Weichen für das nächste Debakel und wollen schon ab Januar die Planungsarbeiten für ein neues Autobahn-Tunnelprojekt in Angriff nehmen.
«Wir haben hier auch die Zustimmung der westastkritischen Organisationen gefunden, was zu Beginn des Prozesses nicht gesichert war», freut sich heimlifeiss der Bieler Stadtpräsident gegenüber dem Bieler Tagblatt. So kann man jetzt gespannt sein, was sich die Funktionäre von VCS, Heimatschutz oder Pro Velo in der Reflexionsgruppe über den künftigen Juratunnel für gescheite Gedanken machen werden…
Auch wenn Behörden, Planer und Fachverbände schon eifrig in den Hinterzimmern ihre Päckli schnüren und ihre Projekte vorantreiben – die Bevölkerung wird diesmal nicht mehr warten, bis es schon fast zu spät ist, um ungewollte Entwicklungen und Bauvorhaben zu verhindern.
Die Menschen im Seeland können und wollen 2021 bei den neuen Planungs- und Entwicklungsvorhaben von Anfang an mitdenken, mitgestalten, mitentwickeln und ihre Vorstellungen für die Zukunft ihrer Stadt und Region einbringen.
Folge 5
DIE PROFITEURE
Rund 65 Millionen Franken Steuergelder wurden bis 2018 laut offiziellen Angaben in die Fehlplanung der Bieler Westast-Autobahn gesteckt (französisch «à fonds perdu», auf Englisch übersetzt: «without any chance of getting it back» und «has been granted with the intention to be lost»). Weitere 1,2 Millionen kostete der Dialog-Prozess, der mit einem Empfehlungsschreiben endet, das nebst hoffentlich griffigen Lenkungsmassnahmen weitere (unsinnige) Planungskosten in Millionenhöhe auslösen wird…
Das alles sei ein Butterbrot, gemessen an den 2,2 Milliarden, die der Bau der Westumfahrung gekostet hätte, tönt es von allen Seiten. Natürlich stimmt das. Dies darf aber kein Freipass für Vetterliwirtschaft sein und dafür, dass der Staat unser Geld mit vollen Händen für Dinge ausgibt, die es nicht braucht – oder für Planungs- und Consultingbüros, die überzahlt sind.
In diese Kategorie gehören zum Beispiel grosszügige Honorare an bereits mit einer stattlichen Pension ausgestattete ehemalige Staatsbeamte. So waren zum Beispiel für Hans Werder – pensionierter UVEK-Generalsekretär – für die Leitung des Westast-Dialogs ursprünglich CHF 80’000 budgetiert. Zu wenig. Bis Ende September 2020 betrugen die aufgelaufenen Kosten bereits über CHF 85’000.

Die dreisteste Offerte für sein Engagement im Dialogprozess hatte Verkehrsexperte Kobi eingereicht – auch er ehemaliger Chefbeamter in Pension. Er stellte seine, wenn auch schon etwas antiquierte Erfahrung zu einem Stundenansatz von CHF 235 zur Verfügung. Grosszügig gewährte er in seinem Budget einen Rabatt von 15% womit die Stunde nur noch CHF 200.—kostete. Bis Ende September 2020 waren ans Büro Kobi Zahlungen in der Höhe von über 92’000 erfolgt. Das Büro von Städtebauexperte Van de Wetering, der sich im Dialogprozess gleich mit einem Doppelmandat einbringen konnte, hatte zum gleichen Zeitpunkt dem Dialogprozess bereits gegen CHF 100’000 verrechnet.
Ein lukratives Mandat war der Dialogprozess aber auch für Hansjörg Ryser und Silvia Frutig, die mit dem Grossauftrag des Dialogprozesses (Sekretariat und Begleitung) gleich einen fetten Fisch zur Lancierung ihrer neuen Firma an Land ziehen konnten. Für das Mandat «Geschäftsführung, Administration, Unterstützung», das sie seit Sommer 2019 gemeinsam mit F+W Communications betreut haben, wurden bis Ende September 2020 rund CHF 165’000 in Rechnung – exklusive «Nebenkosten» wie Kommunikation, Übersetzungen etc.
Weit weniger ins Gewicht fielen die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Kerngruppe sowie Zahlungen an die Interessensorganisationen für die Koordination. Doch auch hier flossen gegen CHF 100’000 an Sitzungsgeldern – obschon die meisten Mitglieder der Kerngruppe als FunktionärInnen oder Behördenvertreter ihre diesbezügliche Arbeitszeit auch ihrem Arbeitgeber verrechnen konnten – und weiterhin können.
Das Gleiche gilt für die Behörden- und VerbandsvertreterInnen in der Dialoggruppe: Sie kassierten von ihren Arbeit- und Auftraggebern selbstverständlich Honorare für ihren Aufwand. Die VertreterInnen der Basisorganisationen hingegen investierten – nicht nur während des Dialogprozesses – Stunden und Tage im Kampf gegen den Westast. Ohne einen einzigen Franken Entschädigung, einzig und allein im Sinne der Sache.
Ihr Lohn: ideelle Genugtuung und Erleichterung; das Westastmonster ist vom Tisch. Der bittere Nachgeschmack: Die Vetterliwirtschaft nimmt weiter ihren Lauf. Noch bevor die Schlussabrechnung für den Dialogprozess vorliegt, wissen wir: Hinter den Kulissen werden längst eifrig neue Päckli geschnürt, Posten zugehalten, Mandate vergeben.
So stellte Regierungsrat Christoph Neuhaus anlässlich der Medienkonferenz vom 17. Dezember in Aussicht, dass baldmöglichst nicht nur mit der Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Massnahmen begonnen werden soll, sondern auch mit der Planung von Port- und Juratunnel…
«Zur Umsetzung dieser Entscheide hat die Behördendelegation beschlossen, im Januar 2021 eine übergeordnete Projektorganisation einzusetzen. (…) Im Weiteren soll eine Reflexionsgruppe bestehend aus den am Dialogprozess beteiligten Fachorganisationen und ‑verbänden gebildet werden (…) Dieses Gremium wird dabei von einer extern beauftragten Projektkoordination geleitet, welche auch die Geschäftsstelle und das Sekretariat der Organisation führt…».
2020 war das Jahr, in dem das ganze Land dem Pflegepersonal für dessen schlecht vergüteten Einsatz an der Covid19-Front Applaus gespendet hat.
Für vergoldete Einsätze im Rahmen des Dialogprozesses und der Projektkoordination 2021 hingegen gibt es Buhrufe und Pfiffe. Weil dieses Geld anderswo besser und sinnvoller eingesetzt werden müsste. Gerade in Zeiten wie diesen…
Sämtliche bisherigen Folgen der
Westast Story: CLICK AND READ
ACH, DIE WINDFAHNEN
So sind die Verbände, die angeblich die Bevölkerung im Dialogprozess vertreten sollen. Mal so, mal so, je nachdem wie der politische Wind weht. Im Dezember 2020 geben sie den Weg frei für einen Langtunnel. Im Februar des gleichen Jahres verbreiteten sie noch eine gegenteilige Botschaft.
DIE STIFTUNG FÜR LANDSCHAFTSSCHUTZ LEHNT
A5-LANGTUNNEL AB
«Statt den Mehrverkehr in Tunnels abzuleiten, sollte der Verkehr auf der ganzen Achse am Bielersee mittels Managementmassnahmen auf ein für die Bevölkerung erträgliches Mass beschränkt werden, zumal ja der SBB-Doppelspurausbau in Ligerz für einen besseren Bahnverkehr sorgt. Zu diesem Zweck sollten die Gemeinde und Region bei Kanton und Bund erwirken, dass der Abschnitt der N5 am linken Bielerseeufer in die Liste der Strassen gemäss Anhang 3 der Nationalstrassenverordnung aufgenommen wird, für die die Kantone Verkehrsmanagementpläne zu erstellen haben. Damit würde auch der Druck auf den Stadtraum Biel reduziert.»
Zur Medienmitteilung SLFP vom 12.02.2020
DIE BEHÖRDENDELEGATION HAT ENTSCHIEDEN
Anlässlich der letzten Sitzung der Behördendelegation scheint es keine grossen Diskussionen mehr gegeben zu haben. Bereits im Verlauf des Vormittags wurde die Medienmitteilung zum Entscheid in Sachen Westast verschickt:
Die wichtigsten Informationen:
- Das Ausführungsprojekt wird abgeschrieben – der Kanton wird bis Ende Jahr dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation einen entsprechenden Antrag stellen.
- Der Kanton will abklären, ob der Porttunnel (Zubringer Rechtes Bielerseeufer) auch ohne übrigen Westast ins Nationalstrassennetz aufgenommen werden kann.
- Die Behördendelegation will «zeitnah die Machbarkeit einer neuen Autobahnlösung prüfen». Im Vordergrund steht ein Tunnel im Jurahang
- Erich Fehr nimmt das Zepter in die Hand: Eine neue Behördendelegation mit dem Namen «Espace Biel/Bienne.Nidau» soll unter dem Vorsitz des Bieler Stadtpräsidenten die verschiedenen in den Empfehlungen des Dialog-Deals aufgeführten Planungen und Massnahmen leiten und koordinieren.
Folge 4
HAUFENWEISE WEIHNACHTSPOST IM BUNDESHAUS
 © Wikimedia Commons
© Wikimedia Commons
Wir stellen uns vor: Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, überquellen die Postfächer im Bundeshaus Nord. Im Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) türmen sich dieser Tage Berge von Couverts und Päckchen mit Neujahrs-Karten und «Aufmerksamkeiten», sogar aus den hintersten Tälern der Schweiz.
Bauunternehmer, Ingenieur‑, Umwelt‑, Planungs- und Consultingbüros bedanken sich für erhaltene Aufträge und preisen ihre Dienste für künftige Mandate an. Ein emsiges Buhlen, adressiert an die Departementsvorsteherin und ihre ChefbeamtInnen, verpackt in Festtagsbotschaften und Neujahrswünsche. Ob es wirklich so ist, wissen nur die bundehausbediensteten PostbotInnen.
Ab und an landet aber auch andere Post auf den Bundesverwaltungsschreibtischen. So voraussichtlich am kommenden Montag oder Dienstag. Wir stellen uns weiter vor, dass dannzumal der zuständige Beamte, die zuständige Beamtin ein gelbes Amts-Couvert zwischen all den gold- und sternchenbeschrifteten Botschaften hervorklauben wird. Adressiert an den Rechtsdienst des UVEK. Absender: Tiefbauamt des Kantons Bern. Möglicherweise ist der unauffällige Briefumschlag nicht einmal frankiert, weil ihn der Berner Baudirektor Christoph Neuhaus in den frühen Morgenstunden, auf dem Weg ins Berner Rathaus, persönlich mit dem Velo an der Pforte des Bundeshauses Nord vorbeigebracht hat.
Dies, weil ihm die Botschaft, die er zu überbringen hat, besonders am Herzen liegt. Es handelt sich dabei um den Entscheid, den die Behördendelegation anlässlich ihres Treffens vom 17. Dezember 2020 gefällt hat: Laut ihrer Medienmitteilung, die sie bereits am Vormittag verschickt hat, geht die Behördendelegation mit der Dialoggruppe einig, «dass das Ausführungsprojekt A5 Westumfahrung Biel/Bienne nicht weiterverfolgt wird.» Das heisst: Das Autobahn-Ausführungsprojekt Westast Biel wird endgültig begraben.
In der Mitteilung ans UVEK dürfte deshalb stehen, dass der Kanton beantrage, das bis zum 31.12.2020 sistierte Auflageverfahren in Sachen Westumfahrung Biel sei nicht wieder aufzunehmen, sondern definitiv abzuschreiben.
Das heisst: Das aufwändige Einspracheverfahren in Sachen «Westumfahrung Biel» wird per sofort eingestellt. Die 650 Einsprechenden dürften im Lauf des Januars vom UVEK ein entsprechendes Schreiben erhalten. Jene, die für ihre Einsprachen Auslagen für einen Advokaten, eine Advokatin hatten, erhalten eine Rückerstattung – alle anderen dürfen einfach bloss aufatmen, dass es vorbei ist. Denn damit ist auch der Enteignungsbann aufgehoben.
Mit der Abschreibung des Gesamtdossiers «Westumfahrung Biel» wird auch der Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel) Makulatur – obschon die Behördendelegation voraussichtlich beantragen wird, dieses Teilprojekt trotz allem zeitnah zu realisieren.
Bereits in der Vergangenheit hatte der Bund mehrfach betont, dass ein Vorziehen oder Auskoppeln von einzelnen Teilprojekten wie dem Porttunnel weder juristisch möglich noch sinnvoll sei. Daran dürfte sich in der Zwischenzeit nichts geändert haben. Dies nicht zuletzt, weil sowohl bei den eingeholten Gutachten sowie bei zahlreichen Einsprachen jeweils auf das Gesamtprojekt «Generelles Projekt Umfahrung Biel West mit Porttunnel» Bezug genommen wurde.
Die klare Rückmeldung aus dem Kanton Bern dürfte dem UVEK deshalb gelegen kommen. Sobald die Einsprechenden informiert und die umfangreichen Auflagepapiere archiviert sind, kann man sich beim Bund zurücklehnen. Denn jetzt ist der Ball wieder beim Kanton Bern: Während der Ausbau des Nationalstrassennetzes 2008 von den Kantonen an den Bund überging, liegt der Auftrag für die «Schliessung von Netzlücken» immer noch bei den Kantonen.
Wie dort die Prioritäten gesetzt werden, dürfte das UVEK kaum interessieren. Insbesondere, wenn es sich um eine für das nationale Mobilitätsnetz so unbedeutende «Lücke» handelt, wie jene in der Region Biel. Deshalb sollte man sich im Kanton Bern sehr gut überlegen, ob es wirklich Sinn macht, erneut Millionen in eine jahrzehntelange Autobahnplanung zu verlochen. Für ein neues aus der Zeit gefallenes Projekt, das voraussichtlich nie realisiert wird.
Sämtliche bisherigen Folgen der
Westast Story: CLICK AND READ
DIE ÜBERFLÜSSIGSTE AUTOBAHN
WESTEUROPAS
Zweispurige «Autobahn» am Bielersee-Nordufer

Sonntag, 13. Dezember 2020, 11.21 Uhr
Jetzt zurückbauen mit Priorität
Velo- und Fussgängerverkehr!
DR BOUDIRAP
DER KUHHANDEL
DIE IRRWEGE DES ASTRA
40-Tönner mit polnischen, tschechischen, französischen, deutschen, österreichischen Nummernschildern – Lastwagen mit Genfer, Aargauer, Luzerner oder St. Galler Kennzeichen… Während der Woche donnert der Schwerverkehr ab morgens 05.00 Uhr erbarmungslos durch die Bieler Seevorstadt und über die N5 dem linken Bielerseeufer entlang.
Weshalb entscheiden sich all die Transportunternehmen für eine Route, die mitten durch die Stadt und über eine Uferstrasse führt, die für solche Monstertrucks eigentlich viel zu schmal ist? Dies, obschon nur wenige Kilometer weiter südlich mit der A1 eine top ausgebaute Autobahn zur Verfügung steht?
Die erstaunliche Antwort lautet: Es ist das Bundesamt für Strassen ASTRA, das den unser Land von Osten nach Westen traversierenden Schwerverkehr über die N5 dirigiert. Seit 2002 betreibt das Bundesamt ein hochoffizielles «Schwerverkehrsportal mit Routenplaner».
Gibt man dort etwa die Strecke St. Gallen – Genf ein, führt der Weg alternativlos über Biel. Andere Navigationstools wie ViaMichelin, Google Maps oder der TCS-Routenplaner schicken die AutofahrerInnen für die gleiche Strecke sinnvollerweise über die A1. Nicht so der Bund.
Warum? Ein Programmierungsfehler? Oder weil die Strecke über Biel – kilometermässig – rund 5 km kürzer ist als jene über die A1? Oder schlicht und einfach, um die A1 zu entlasten?
So geht es nicht, liebe Astra-Leute. Was auch immer eure Gründe sein mögen, die Menschen in der Bieler Seevorstadt und in den Dörfern am See haben genug gelitten. Der zunehmende Schwerverkehr zerstört ihre Lebensqualität und beeinträchtigt die Umwelt. Der Transitverkehr gehört nicht auf diese Strecke!
Deshalb forderte das Komitee «N5 – Bielersee so nicht» im Sommer dieses Jahres in einer Petition ans UVEK nebst einem Planungsstopp beim Twanntunnel, der nur den Dorfkern vom Lärm entlasten würde, ein Transitverbot für den Schwerverkehr. Weil dieser auf die A1 gehört.
Unterstützt wird das Anliegen auch vom Westast-Dialog in Biel: In den von AutobahngegnerInnen wie ‑befürworterInnen und Behörden gemeinsam verabschiedeten Papier, das am kommenden Montag Regierungsrat Neuhaus überreicht wird, steht in der Rubrik für kurzfristige Massnahmen ebenfalls die Forderung für ein Lastwagen-Transitverbot auf der Strecke Bözingenmoos bis La Neuveville.
Also, liebe Astra-Programmierer: Statt den Schwerverkehr über Biel zu lenken, heisst es in Zukunft: Lastwagen ultimativ auf die A1. Auf der N5 zwischen Biel und La Neuveville haben sie nichts verloren.
Der Astra-Routenplaner sorgt übrigens nicht nur im Berner Seeland für Kopfschütteln. Ein Fallbeispiel zeigt, dass auch anderswo der Schwerverkehr auf abenteuerliche Wege führt…
«Mit Astrid unterwegs» – wie das Astra die Lastwagenchaufeuse in die Irre führt
AUFATMEN UND WEITERKÄMPFEN
Das aktuelle Westast-Ausführungsprojekt wird – mit Ausnahme des Porttunnels – nicht weiterverfolgt. So wie es aussieht, sind die innerstädtischen Autobahnanschlüsse vom Tisch. Zumindest einer: Bienne-Centre beim Bahnhof dürfte definitiv nie gebaut werden…
Für die WestastgegnerInnen im Mühlefeld und Gurnigelquartier haben sich Widerstand und Durchhaltevermögen gelohnt. Sie haben ihr Ziel erreicht: Das Eigenheim ist gerettet, die Idylle rund ums Haus bleibt erhalten. Dankbar und zufrieden greifen die müden Kämpfer nach dem vermeintlichen Kompromiss und ziehen sich hinter ihre Gartenhecken zurück.…
Aber Achtung: Die Autobahnära in der Region Biel ist längst noch nicht Geschichte. Der aktuell viel gerühmte «historische Dialogkompromiss» öffnet Tür und Tor für weitere Autobahnplanungen.…
Warum sich die Westast-Opposition jetzt nicht zurücklehnen und zu laut feiern sollte, und was es mit dem Buebetrickli auf sich hat:
WO IST DER STAU UND WARUM?
EIN GESCHENK FÜR BIEL
Über 700 Bäume atmen auf und mit Ihnen alle Freunde und Freundinnen des Bieler Strandbodens. Das endgültige Aus für das Autobahnprojekt bedeutet nämlich nichts anderes, als dass das Schmuckstück der Stadt Biel am See nicht zerstört wird. Dort und im angrenzenden Gebiet wären hunderte von prächtigen Bäumen der Motorsäge zum Opfer gefallen. Dieser Alptraum ist nun einfürallemal vorbei.
Die heutige Generation hat 2020 ihre Pflicht getan und den Strandboden für die künftigen BewohnerInnen der Stadt Biel in Schutz genommen. Niemand wird es wagen, in den kommemnden 25 Jahren hier mit einer Motorsäge aufzukreuzen, ausser wenn ein alterskranker Baum durch einen neuen zu ersetzen ist.
© Anita Vozza
Die Bielerinnen und Bieler dürfen stolz auf das Erreichte sein: es war viel Handarbeit von Freiwilligen vonnöten, um die geplante Stadtzerstörung zu verhindern.
© Anita Vozza
Symbolbild 2010 – 2050
Und last but not least: Auch das Neptunhüsli bleibt!
SUPER MEDIENECHO
EASY RIDER AUF DER ÜBERHOLSPUR
«Als Harley-Davidson 1903 erstmals Energie auf zwei Räder lenkte, änderte dies die Art und Weise, wie sich die Welt fortbewegte…», heisst es im jüngsten Werbespot der Firma.
Mit seiner jüngsten Kreation reagiert der Motorradpionier auf die Veränderungen in dieser Welt, die auch neue Formen der Fortbewegung erfordern. Nachdem Harley-Davidson bereits als erster grosser Hersteller ein Elektromotorrad präsentiert hat, folgt nun das Easy-Rider Elektrobike Serial 1 Cycle Company.
Mit den E‑Bikes verlagert sich das Lebensgefühl von Freiheit und Abenteuer auf Radwege und Bike-Trails. Ein Trend, der längst im Gang ist. Nur Ewiggestrige setzen weiterhin auf den Bau von Autobahnen und Autobahntunnel, um künftigen VerkehrsteilnehmerInnen ihre Freiheit zu sichern.
 © Serial 1
© Serial 1
STANDPUNKT EINES UNTERNEHMERS

«ES MUSS ETWAS GEHEN!»

Weniger als zwei Wochen brauchten die PetitionärInnen, um mit einer einmaligen Aktion gegen 900 Unterschriften für die «Rettung des linken Bielerseeufers» zu sammeln. Nicht übers Internet – darauf haben sie bewusst verzichtet, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Diese Gespräche haben nun klar und deutlich gezeigt, wie vielen Menschen der Schutz des Bielerseeufers ein Anliegen ist.
Dazu zählen nicht nur die direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner, die werktags schon ab morgens um 5 Uhr durch die ersten Lastwagen geweckt werden und enorm unter den Lärm- und Abgasemissionen des Schwerverkehrs leiden. Unterschrieben haben auch Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung, die den Wert dieser fragilen Landschaft erkannt haben und die drohende weitere Verschandelung des Bielersee-Nordufers durch überdimensionierte Strassenbauten verhindern wollen.
Man ist sich weitgehend einig: «Es muss etwas geschehen!» Die geplante Verlängerung des Ligerztunnels, die einzig den Dorfkern von Twann vom Transitverkehr entlasten würde, reicht nicht und zieht zusätzlichen Schwerverkehr auf die N5 an. Eine Mehrheit der AnwohnerInnen des Seeufers, die an der offen geführten Strecke von Wingreis über Tüscherz und Alfermée nach Biel lebt, würde dadurch nicht vom Verkehrslärm befreit. Auch die Spazierwege wären weiterhin dauerbeschallt, die Baustelle und das Tunnelportal in Wingreis würden unheilbare Wunden hinterlassen. Kurzum: Es braucht andere Lösungen – die auch kurzfristig die Situation verbessern.

Die Petition kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Im Rahmen des Dialogprozesses in Biel wurden in den letzten Monaten eine Reihe sogenannt «kurz- und mittelfristiger Massnahmen» erarbeitet. Grundlage dafür ist die 4‑V-Strategie des Kantons Bern, die in Bezug auf den Verkehr klare Prioritäten festlegt: A. Verkehr vermeiden – B. Verkehr verlagern – C. Verkehr verträglich gestalten – D. Verkehr vernetzen.
Diese Strategie gilt selbstverständlich für die ganze Region. Angewendet auf das linke Bielerseeufer stehen zwei Lenkungsmassnahmen im Vordergrund, die SOFORT umsetzbar wären – vorausgesetzt, die Politik setzt sich dafür ein:
- Ein Transitverbot für den Schwerverkehr Tempo 60 auf der gesamten Strecke zwischen Biel und La Neuveville. Dies, weil die N5 als Autobahn 3. Klasse mit Radstreifen ein völlig ungeeigneter Korridor für den Transit-Schwerverkehr ist. Ein beachtlicher Teil der Lärm- und Abgaserzeugung wäre damit vom Seeufer ferngehalten.
- Generell Tempo 60 auf der gesamten Strecke zwischen Biel und La Neuveville. Die Vereinheitlichung der Geschwindigkeitslimite beruhigt den Verkehrsfluss und bietet für Autofahrende und den Veloverkehr mehr Sicherheit und Komfort.
Diese Massnahmen kämen auch den Städten Biel und Nidau zugute, weil damit die Attraktivität der N5 als Schleichweg und Ausweichstrecke für die A1 drastisch sinken würde.

Mit der Einreichung der Petition am 4. September 2020 liegt der Ball nun beim UVEK sowie bei Bundespräsidentin und Departementsvorsteherin Sommaruga. Am Bielersee und in Biel wartet man gespannt auf eine Antwort und setzt auf die Lernfähigkeit der Behörden: Der Westast-Dialog und die Verkehrsprobleme am linken Bielerseeufer sind eng miteinander verknüpft – und verlangen nach einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise. Im Gegensatz zu Biel, wo seit der Eröffnung des Ostasts (ausser dem Transit-Schleichverkehr) keine nennenswerten Verkehrsprobleme für Motorfahrzeuge bestehen, braucht es am linken Bielerseeufer aber dringend Lenkungsmassnahmen, um die Lärmbelastung baldmöglichst zu reduzieren!
Weitere Informationen, die offizielle Medienmitteilung, Bilder und Medienberichte auf der Website des Komitees
PHANTOM JURATUNNEL
In den letzten Monaten und Wochen ist der Westast-Dialog in eine erstaunliche Richtung abgedriftet. So macht etwa Moderator Hans Werder keinen Hehl daraus, dass er dem Kanton und der Behördendelegation Ende Jahr die Variante «Juratunnel» als Lösungsvorschlag präsentieren möchte.
Dies tut er notabene in enger Übereinstimmung und mit tatkräftiger Mithilfe seines Sparringpartners Fritz Kobi, der neuerdings plötzlich für unterirdische Stadtanschlüsse wirbt. Dies, obschon beide Herren – der eine als «Moderator», der andere als «Verkehrsexperte» – gemäss ihren Rollen im Dialogprozess eigentlich zu einer neutralen Haltung verpflichtet wären.
DAS WUNDER VON BIEL

«Das Westast-Ausführungsprojekt wird nie wie vorgesehen gebaut werden.»
Dies erklärte der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr an der Sitzung der Kerngruppe vom 11. August 2020. Damit wird dieser Tag als Meilenstein in die Geschichte des Westast-Dialogs eingehen: So klare Worte in Sachen Westast hat man vom Bieler Stadtpräsidenten schon lange nicht mehr gehört – dass er sich deutsch und deutlich gegen das Ausführungsprojekt ausspricht, ist so neu wie begrüssenswert.
Im Klartext: Nachdem sich der Bieler Stadtpräsident – während Jahren ein vehementer Verteidiger des Ausführungsprojekts – vor zwei Jahren aufgrund des Widerstands aus der Bevölkerung für den Dialogprozess stark gemacht hat, geht er nun einen entscheidenden Schritt weiter und erklärt den geplanten Westast mit den beiden innerstädtischen Anschlüssen unter anderem laut Bieler Tagblatt für «politisch tot».
Gegenüber Telebärn sagte Fehr, man habe im Dialogprozess viel gelernt. Dabei hätte sich gezeigt, dass das Ausführungsprojekt für die Bedürfnisse der Stadt von morgen nicht die richtige Lösung sei – weshalb man nun weiter suchen müsse für eine gute, zukunftsfähige Lösung.
Die Westast-Befürworterschaft – deren VertreterInnen in der Kerngruppe sind unter anderem die Bieler Stadtratsmitglieder Cécile Wendling und Peter Bohnenblust sowie die Nidauer Gemeindepräsidentin Sandra Hess – hält auch nach über eineinhalb Jahren Dialogprozess am Ausführungsprojekt fest, wie an der gestrigen Medienkonferenz einmal mehr deutlich wurde.
In Biel stehen Wahlen in Stadtregierung und ‑parlament an. Das heisst: In Sachen Westast kann jetzt auch die Bevölkerung endlich wieder einmal ihre Meinung kundtun, indem sie ihre Stimme jenen Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die sich für zukunftsfähige Lösungen für ihre Stadt und Region einsetzen.
Der anfänglich belächelte, langjährige Widerstand gegen den Bieler Westast hat also genützt. Nicht zuletzt, weil sich je länger desto klarer zeigt, wie sehr das Autobahnprojekt aus der Zeit gefallen ist und den Bedürfnissen einer zukunftsfähigen Stadt- und Regionalplanung widerspricht. Dass sich der Bieler Stadtpräsident gestern definitiv vom «toten» Westastprojekt verabschiedet hat, ist ein erfreuliches Zeichen.
«CORONA» BAHNT DEN WEG: DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN

Die Corona-Krise hat auch positive Seiten. Dank dem drastischen Rückgang des Verkehrs und dem weitgehenden Grounding der Flugflotten ist nicht nur Ruhe eingekehrt, auch die Luft ist besser geworden. Vielerorts werden sich die Menschen erst jetzt bewusst, was Lebensqualität auch noch bedeuten könnte; wie zermürbend die Dauerbeschallung ist, und wie weit der Himmel wird, ohne Kondensstreifen…
Wer aber in diesen Tagen zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs ist, stellt immer wieder fest: Der Platz auf den Trottoirs und Wegen ist eng. Der geforderte Abstand von zwei Metern kann kaum eingehalten werden, wenn sich FussgängerInnen kreuzen, wenn Velos und JoggerInnen sich die engen Bahnen, die für den «Langsamverkehr» reserviert sind, teilen müssen.

Deshalb schafft die Stadtregierung von Mailand mit zukunftsweisenden Sofortmassnahmen jetzt Abhilfe: 35 Strassenkilometer werden ab sofort in Velo- und Fusswege umfunktioniert – um die Bevölkerung auch nach der Aufhebung des Lockdowns weiterhin vor Ansteckungen zu schützen. «Wenn alle mit dem Auto unterwegs sind, hat es zu wenig Platz für die Menschen, es gibt keinen Raum um sich zu bewegen», fasst Marco Granelli, Vizebürgermeister und Verkehrsdirektor von Milano zusammen.
Die Hauptstadt der Lombardei hat schwere Wochen hinter sich, hier wütete das Corona-Virus besonders heftig. Der rigorose Lockdown – Italienerinnen und Italiener dürfen das Haus nach wie vor nur für dringliche Geschäfte und mit Erlaubnis verlassen – leerte die Strassen und verminderte die Luftverschmutzung.
Der «Piano Strade Aperte», den die Stadtregierung am 21. April der Öffentlichkeit vorgestellt hat, soll ab sofort bis im Sommer umgesetzt werden. Er sieht auch ausgedehnte Tempo 30-Zonen vor sowie drastische Restriktionen für den motorisierten Verkehr in ausgewählten Quartieren.

«Natürlich wollen wir die Wirtschaft wieder hochfahren, aber wir sind überzeugt, dass wir dies auf einer anderen Basis machen müssen, als zuvor», erklärte Vizebürgermeister Granelli gegenüber den Medien. «Wir müssen Mailand neu denken. Wenn alles vorbei ist, sind jene Städte im Vorteil, die diesen Schritt als erste machten. Und Mailand will zu dieser Kategorie gehören.»
Anfang Mai soll mit der Umsetzung angefangen werden. Als erstes wird zum Beispiel der 8 Kilometer lange Corso Buenos Aires, eine der wichtigsten Einkaufsstrassen von Milano, einen neuen Veloweg sowie erweiterte Trottoirs erhalten.
Ein Vorbild, auch für andere Städte, wie Janette Sadik-Khan betont. Die Verkehrsfachfrau aus New York City berät aktuell zahlreiche Städte im Umgang mit der Krise. Sie erklärte gegenüber der Zeitung «The Guardian»: «Der Plan von Mailand ist sehr wichtig, weil er ein gutes Drehbuch dafür ist, wie wir unsere Städte wieder in Betrieb nehmen können. Uns bietet sich eine historische Gelegenheit, die Strassen mit frischem Blick zu sehen und dafür zu sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen: Es geht nicht bloss darum, Autos so schnell wie möglich von Punkt A zu Punkt B zu bewegen. Alle müssen die Möglichkeit haben, sich sicher fortzubewegen.»
Eine Einsicht, die vielleicht irgendeinmal auch in der Schweiz, in Bern – und sogar im Berner Seeland ankommt. Jetzt ist der Moment, die Weichen definitiv umzustellen – und dem sogenannten «Langsamverkehr» den erforderlichen Raum zu schaffen.
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Hoppla! Es geht was in der Stadt Biel:
klick und lies
![]()
Häb Sorg zur Stadt freut sich:
Todesstoss für den A5-Westast
Die Zukunft beginnt. Der Güterverkehr in der Schweiz kommt zu grossen Teilen unter den Boden. Das Autobahnstrassennetz wird markant entlastet. Der A‑5 Westast wird vollends überflüssig. Am ganzen Nordwestufer des Bielersees braucht es statt Autobahnausbau mit teuren Tunneln ein Transitverbot für den überregionalen Schwerverkehr.
Der Runde Tisch zum A5-Westast wird diese bahnbrechende Neuausrichtung der Schweizer Verkehrspolitik in seinen Empfehlungen berücksichtigen müssen.
DER WESTAST-WIDERSTAND ALS VORBILD

«Wie stoppt man ein Autobahnprojekt?» lautete der Frontaufmacher im Bund. Nach wochenlangen Recherchen ist der von langer Hand angekündigte doppelseitige Artikel endlich erschienen. Darin versuchen zwei Berner Journalisten zu rekonstruieren, wie es zur aktuellen Sistierung des offiziellen Westast-Projekts gekommen ist.
Ihre Motivation: Mittlerweile ist der Widerstand gegen den A5-Westast zum Vorbild für AktivistInnen in der ganzen Schweiz geworden. Deshalb gingen sie der Frage nach, wie dieser Erfolg in einem anfänglich aussichtslos erscheinenden Kampf überhaupt möglich war.
Fleissig haben die beiden Journalisten laut eigenen Angaben gegen 30 Personen befragt. Vieles haben sie zusammengetragen, miteinander in Beziehung gebracht. Und trotzdem das Wichtigste vergessen…
Hier deshalb — für alle, die nach einer «Anleitung» für erfolgreichen Widerstand gegen unsinnige Strassenprojekte suchen — einige Ergänzungen und Korrekturen. Denn das Herz und die Basis für den Erfolg des Widerstands sind die unzähligen engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich mit immer neuer Eigeninitiative, unglaublicher Kreativität, Hartnäckigkeit – vor allem aber auch mit viel Lebensfreude und Optimismus – der Zerstörung ihres Lebensraums widersetzen.
Die Stadtwanderungen entlang der Zerstörungsachse, die ab Frühjahr 2016 durchgeführt wurden, waren nicht, wie dies der Bund-Artikel suggeriert, eine Erfindung medienversierter Komiteemitglieder – im Gegenteil: Die Stadtwanderungen zielten darauf, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort selber informierten. Unter kundiger Führung von AktivistInnen, welche die Pläne minutiös studiert hatten und nun entlang der geplanten Autobahnachse mit detaillierten Zahlen und Fakten das Bauvorhaben erläuterten. Dank Mund-zu-Mund-Propaganda wurden diese Ortstermine schnell zum Erfolg. Allerdings dauerte es sehr lange, bis sich regionale MedienvertreterInnen für diese Ortstermine interessierten…

Während die Medien noch schwiegen, verteilten engagierte AktivistInnen Flyer in Tausende von Briefkästen in Biel und den umliegenden Gemeinden, um die Bevölkerung auf diesem Weg über das geplante Monsterprojekt zu informieren. Sie waren tage- und wochenlang unterwegs und erreichten, dass die Bevölkerung der Stadt, die grösstenteils bis anhin noch nie etwas vom «Westast» gehört hatte, über die Ausmasse der geplanten Eingriffe informiert wurde.

Während sich JournalistInnen immer noch schwer taten, die wachsende Bewegung ernst zu nehmen und über den Westastwiderstand zu berichten, sorgten unermüdliche LeserbriefschreiberInnen dafür, dass die geplante Autobahn nun regelmässig ihren Platz in den Zeitungen erhielt. Pensionierte Ingenieure, kreative MitdenkerInnen präsentierten alternative Ideen und Varianten – und trugen ihrerseits dazu bei, dass die Behörden ihre Autobahnpläne nicht länger unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorantreiben konnten.
Im Vorfeld der öffentlichen Planauflage tauchten dann plötzlich überall in Biel und Nidau – ja sogar in Port Stopp-Westastplakate und Blachen auf. Mittlerweile war der Westast zu einem Stadtthema geworden, was dazu führte, dass beim UVEK über 650 Einsprachen eingingen – sowohl von Privaten wie von grossen Verbänden wie dem VCS oder der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
Quasi im Alleingang organisierte eine Westast-Kritikerin im Mai 2017 einen Veloflashmob: Innert weniger Tage schaffte sie es, über ihre Netzwerke und soziale Medien mehr als 1200 Menschen zu mobilisieren. Die friedliche Demonstration, die in guter Zusammenarbeit mit der Bieler Polizei durchgeführt wurde, war ein Schlüsselmoment im Westast-Widerstand und ermutigte die TeilnehmerInnen, sich weiter zu engagieren. So schuf der Flashmob die Basis, welche die grossen Demos im Herbst 2017 und 2018 erst ermöglicht hat.

Als publik wurde, dass 745 Bäume für den Westast gefällt werden sollen, entstanden spontan, aus der Mitte der Bevölkerung, neue Aktionen. Sie wurden weder von einer Organisation geleitet noch von einem Komitee gesteuert: AktivistInnen markierten auf eigene Faust wiederholt jene Bäume mit Plakaten, die dem Westast geopfert würden. Diese Baumaktionen hatten eine überwältigende Wirkung: Für viele BürgerInnen wurde erst jetzt deutlich, welche Zerstörungsdimensionen der Westast hat. – Und die Baumaktionen gehen weiter: Vor wenigen Wochen hat eine junge Frau, zusammen mit Gleichgesinnten, aus eigenem Antrieb zahlreichen bedrohten Bäumen «ein Gesicht verliehen».

Man könnte unzählige weitere Aktionen aufzählen, die von immer wieder anderen AktivistInnen initiiert wurden. Um nur einige zu nennen: Die Unterschriftensammlung für eine Petition gegen den Westast, das Fest im Müller Museum oder die Tavolata, wo AktivistInnen gemeinsam mit QuartierbewohnerInnen ein Strassenfest feierten – genau dort, wo die Westastschneise dereinst die Stadt zerschneiden würde.
Fazit: Der bisherige Erfolg des Westast-Widerstands basiert auf einer breiten Bewegung, die immer wieder neue kreative Ideen umsetzt – und so auch immer wieder neue Menschen zum Mitmachen ermutigt. Weil es genau genommen um weit mehr geht, als um das Verhindern eines Betonmonsters…

Genauso so, wie der vielfältige Widerstand funktioniert, müsste übrigens auch die Lösungssuche erfolgen, soll sie langfristig Erfolg haben: Es braucht einen transparenten offenen Prozess, wo kreative Ideen aus der Bevölkerung und aus verschiedenen Generationen einfliessen. Varianten hingegen, die von Planern unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstellt werden, sind weder zeitgemäss noch zielführend.
Dies eine kurze aber wichtige Ergänzung zum oben erwähnten Bund-Artikel…
INNOVATIVE ANSÄTZE FÜR DEN GÜTERVERKEHR
Ein Zulassungsverbot für fossil betriebene Lastwagen ab 2030 sowie ab 2035 ein Fahrverbot auf alpenquerenden Routen – eine entsprechende Volksinitiative könnte schon bald Realität werden, wie der Tagesanzeiger vom 6. Juni 2019 berichtet:
Dabei geht es in erster Linie um Umwelt- und Klimaschutz. Jon Pult, Präsident der Alpeninitiative und SP-Nationalrat begründet: «Geht es im Bundesrat und Parlament jetzt nicht rasch genug vorwärts, werden wir das Heft selber in die Hand nehmen.»
Bereits im letzten Dezember hatte der Verein Alpen-Initiative eine in ihrem Auftrag erstellte Studie publiziert, die zeigte, dass bei den Lastwagen in Sachen Reduktion der CO2-Emissionen seit 1990 wenig Fortschritte gemacht wurden. Schon damals forderte Jon Pult: «Es ist eine verpasste Chance, dass der Strassengüterverkehr bei der laufenden CO2-Gesetzesrevision im Parlament überhaupt kein Thema ist. Lastwagen dürfen nicht aus dem Gesetz ausgeklammert werden. Die Zeit drängt: Um die Klimaerwärmung zu stoppen und die Reduktionsziele des Pariser Abkommens zu erfüllen, müssen die Treibhausgasemissionen in allen Bereich reduziert werden.»
Mit der angekündigte Initiative liegt nun ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch. Nebst dem vorgeschlagenen Zulassungs- und Transitverbot für fossil betriebene Lastwagen, schlägt die Initiative auch bei der Schwerverkehrsabgabe (LSVA) Neuerungen vor: Ab 2020 soll die sich die LSVA nach dem Verursacherprinzip richten: Je grösser der CO2-Ausstoss eines Lastwagens ist, desto mehr muss er bezahlen.
Solche Innovationen kommen bei der Transportbranche nicht gut an. Sie liegen aber im Trend: Eine Abstufung der Lastwagensteuern nach CO2-Emissionen ist auch in der EU ein Thema. In Norwegen sollen schon ab 2025 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Schweden und Dänemark peilen für 2030 ein Verbot für Diesel und Benziner an.
Mit dem angedachten Transitverbot für Diesel-Laster geht die Alpen-Initiative allerdings noch einen Schritt weiter. Doch sogar da könnte man den Faden noch weiter spinnen: Weshalb nur ein Fahrverbot im alpentraversierenden Verkehr? Auch die Städte und Dörfer im Mittelland könnten aufatmen, wenn künftige Gütertransporte auf der Strasse gestanksfrei und lärmarm erfolgten.
Das alles sind Denkanstösse, die in die richtige Richtung zeigen. Es lohnt sich, sie weiter zu verfolgen…

BYPASS A5-WESTAST: NEIN DANKE!
Das linke Bielerseeufer gehört zu den geschützten Landschaften der Schweiz. Die Linienführung der A5 entlang dem See und durch die Rebberge war ein Fehlentscheid – darüber sind sich heute alle einig.
Der Transitverkehr schadet den Menschen und der fragilen Umwelt in den Winzerdörferna am Jurasüdfuss.
Der Bau des Westasts hätte zur Folge, dass noch mehr Autos und Lastwagen diese Route wählen, was die Situation drastisch verschärfen würde…
OFFIZIELL UND INOFFIZIELL
BUNTE EINIGKEIT
Die Vielfalt der Westastopposition ist ihre Stärke

Die Spatzen pfeifen es von den Bieler Dächern: Die Westast-Opposition sei sich nicht einig. Und es gibt Journalisten, die gar einen Streit herbeipfeifen wollen. Ein aufgeregtes Gezwitscher, das völlig aus der Luft gegriffen ist und an den Realitäten vorbeizielt.
Im Gegensatz zum Westast-JA-Lager, das eine simple Message vertritt («baldmöglichste Umsetzung des Ausführungsprojekts»), gibt es auf Seiten der Gegnerschaft eine interessante Vielfalt von Ideen, Vorschlägen und Varianten.
Das liegt in der Natur der Sache: Seit Jahren beschäftigen sich viele aus der Westast-Opposition mit der Suche nach Alternativen. Es ist eindrücklich, wie viele Ideen, wie viel Kreativität in den letzten Jahren freigesetzt worden ist – immer mit dem gleichen Ziel: Die drohende Stadtzerstörung zu verhindern und andere, zukunftsfähige Lösungswege aufzuzeigen.
Gerade in dieser Vielfalt, liegt die Stärke der Opposition: Sie bringt eine breite Palette von Kompetenzen in den Dialogprozess. Es braucht die Vielstimmigkeit der verschiedenen Gruppierungen für den von Regierungsrat Neuhaus angestossenen «ergebnisoffenen Dialog». Wer diese Vielfalt wegdiskutieren will, kann sich geradesogut mit zwei Leuten – einmal pro, einmal kontra – an den Runden Tisch setzen.
Am Runden Tisch sind aber 13 Organisationen vertreten:
-
-
- Berner Heimatschutz
- Fussverkehr Kanton Bern
- IG Häb Sorg zur Stadt
- Komitee «Biel notre Amour»
- Komitee «Westast so nicht»
- Verein «Biel wird laut»
- Verein «Gruppe S»
- Verein LQV – Lebensqualität
- Pro Natura
- Pro Velo
- Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
- VCS Bern
- WWF Bern
-
Diese alphabetische Aufzählung zeigt: Die Gegnerschaft ist breit aufgestellt. Es versteht sich von selber, dass eine national tätige Schutzorganisation andere Prioritäten setzt als ein Quartierverein. In einem Punkt sind sie sich aber zu hundert Prozent einig: Sie werden nie Hand bieten zu den zwei offenen Autobahnschneisen mitten in der Stadt.
Klarheit und Vielfalt sind gewollt für einen Runden Tisch, der nicht eine Alibiübung darstellen soll: Jede Gruppierung bringt ihre Facetten, ihre Stärken in den Dialog. Es braucht sie alle, um die Breite der Opposition gegen das Ausführungsprojekt zu widerspiegeln. Damit ist die Basis für eine echte Partizipation der Bevölkerung gelegt.
All jene, die immer wieder versuchen, einen Streit in der Gegnerschaft herbeizureden oder zu ‑schreiben müssen wir deshalb enttäuschen: Der Kampf gegen die drohende Stadtzerstörung wird in bunter Einigkeit und mit voller Kraft geführt. Auch in Zukunft. Wenn die PRO-Westast-Anhänger keine anderen Argumente beibringen können, als der Opposition Uneinigkeit anzudichten, dann ist es gut möglich, dass der A5-Westast hochkant vom Runden Tisch fliegen wird.
WIRTSCHAFT GEGEN
A5-WESTAST
Nun melden sich mehr und mehr Westast-GegnerInnen aus der Wirtschaft zu Wort! Zwar haben sich bereits in der Vergangenheit vereinzelt UnternehmerInnen und WirtschaftsführerInnen gegen das veraltete und viel zu teure Autobahnprojekt ausgesprochen. Allen voran Michel Muller, CEO der Muller Machines SA, deren einmaliges Maschinenmuseum dem Westast weichen müsste.
Nachdem nun aber die Wirtschaftsverbände HIV Kanton Bern, KMU Bern und WIBS Ende letzten Jahres eine vollmundige Kampagne Pro-Westast lanciert hatten, gibt es nun massive Kritik an diesem Vorgehen – und eine Gegenkampagne:
So schreibt WIBS-Gründungsmitglied Lukas Weiss in seinem Leserbrief im «Biel-Bienne»: «Ich bin entsetzt, mit welcher Dreistigkeit dieses wichtige lokale Forum als Plattform für eine einseitig geführte Kampagne missbraucht wird. Als Mitglied der WIBS wurde ich nie zu meiner Meinung zum Westast befragt.»
Auch der ehemalige HIV-Präsident und CEO der Biella AG, Rudolf Bürgi, spricht im Interview mit Mario Cortesi Klartext: «Der wirtschaftliche Nutzen dieser 2,2 Miliarden Franken-Investition ist nicht belegt. Es ist befremdend, dass die Befürworter darauf drängen, die bereitgestellte Investitionssumme jetzt auszugeben.»
VertreterInnen der Wirtschaft haben nun, in Zusammenarbeit mit dem Komitee «Westast so nicht!» ihrerseits eine Inseratenkampagne gestartet, um ihre Opposition gegen das Ausführungsprojekt und das Vorgehen der Wirtschaftsverbände publik zu machen.
DIE RICHTIGE FRAGE STELLEN
Nicht immer führen Umfragen zum erwarteten Resultat. So dürften sich die Westast-Befürworter nach der Demoscope-Umfrage die Augen gerieben haben: Gerade mal 21% der Befragten hatten sich für das Ausführungsprojekt mit den beiden innerstädtischen Anschlüssen ausgesprochen.
Damit hatte man ganz offensichtlich nicht gerechnet. Wie sonst ist zu erklären, dass die Präsentation der Umfrage-Resultate als Highlight einer Lobby-Veranstaltung gedacht war?
Nun, dieser Schuss ging nach hinten los. Seither werden Westast-Befürworter nicht müde, die Fragestellung in Frage zu stellen. Allerdings hat von ihnen noch keiner gesagt, wie denn anders hätte gefragt werden müssen…
Letztendlich geht es um eine einfache Frage, die lautet: Ausführungsprojekt ja oder nein? Punkt. Schluss.
Diese Frage könnte demnächst nicht per Telefon, sondern via Stimmzettel beantwortet werden. Stadtratspräsidentin Ruth Tennenbaum und vier weitere Mitglieder des Stadtrats verlangen nämlich mit einer dringlichen Motion, die sie im November eingereicht haben, eine möglichst baldige Konsultativabstimmung über den Westast.
Diese Abstimmung hätte zwar für die Autobahnbauer keine bindende Wirkung. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass weder das ASTRA noch der Kanton gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit vorgehen wird.
Umso wichtiger ist, dass die Frage bei der Konsultativabstimmung eindeutig und richtig gestellt wird. Kein Wunschkonzert mit der Auswahl «WESTASToffiziell» oder «WESTAST-so-besser» oder «WESTASTvariante XYZ». Bevor man über irgendwelche anderen Varianten diskutieren kann, braucht es einen klaren Grundsatzentscheid. Beim zu erwartenden Nein liegt der Ball wieder bei der Politik, die – in Zusammenarbeit mit der interessierten Bevölkerung – zeitgemässe, akzeptable Konzepte präsentieren soll.
Die Frage bei einer allfälligen Konsultativabstimmung lautet daher klar und simpel: Wollt ihr das Ausführungsprojekt «A5-Westumfahrung Biel» – JA oder NEIN?
OSTAST SCHAFFT WESTAST AB
Ende Oktober 2018 wurden die Resultate der Verkehrszählungen, die seit der Ostast-Eröffnung erhoben wurden, publik. Sie bestätigen, was BeobachterInnen schon lange festgestellt haben: Das prognostizierte Verkehrschaos im Bereich der geplanten Westast-Autobahn ist ausgeblieben.
Mehr noch: Statt der angedrohten Mehrbelastung hat sogar auf dem Guido-Müller-Platz, auf der Ländtestrasse oder im Stedtli Nidau die Zahl der an einem durchschnittlichen Werktag gezählten Fahrzeuge abgenommen, wie der heute im Bieler Tagblatt publizierten Tabelle zu entnehmen ist.
Daraus ziehen wir zwei Schlüsse:
1. Die vor der Ostast-Eröffnung erstellten Verkehrsprognosen waren daneben: Die von den Autobahnbefürwortern heraufbeschworenen Chaos-Szenarien sind ausgeblieben. Das den Berechnungen zugrunde liegende Modell geht von falschen Annahmen aus. Mit dem gleichen Modell soll auch der Bau des Westasts gerechtfertigt werden.
2. Der Westast ist definitiv überflüssig – in der Region Biel braucht es keine weiteren Strassenkapazitäten. Die Verkehrssituation kann und muss weiter optimiert werden durch die Umsetzung der noch ausstehenden flankierenden Massnahmen sowie weiterer Lenkungsmassnahmen und Verbesserungen beim ÖV und für den Fuss- und Veloverkehr.

Nicht nur Biel, auch die umliegenden Gemeinden profitieren langfristig von einem Verzicht auf den Westast! Eine zukunftsfähige Entwicklung der Region trägt der Landschaft Sorge. Denn fest steht: Der Ostast bringt zwar Entlastung für die Stadt und darüber hinaus – doch schön und menschenfreundlich ist auch dieses Infrastrukturbauwerk nicht. Dazu Marc Meichtry, Gemeindepräsident von Brügg gegenüber dem Bieler Tagblatt: «Wenn man dem Brügger Waldrand entlang spaziert, dann sieht man den massiven Einschnitt in die Natur. Bis weit in den Wald hinein ist das Rauschen der Autobahn zu hören.»
Deshalb gilt es nun mit allen Mitteln, den unnötigen, zerstörerischen Westast zu verhindern!
ÜBUNGSABBRUCH!
 In ihrer Medienmitteilung vom 8. Oktober 2018 bringt es die SL auf den Punkt: «Die amtliche Westast-Variante ist in grossen Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert und aus Umweltsicht auch nicht bewilligungsfähig.» Sie schlägt deshalb vor, «ein ‹Reset› in Form einer partizipativen, zukunftsgerichteten Verkehrsplanung zu starten, die der Bevölkerung und dem Stadtbild gerechter wird.»
In ihrer Medienmitteilung vom 8. Oktober 2018 bringt es die SL auf den Punkt: «Die amtliche Westast-Variante ist in grossen Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert und aus Umweltsicht auch nicht bewilligungsfähig.» Sie schlägt deshalb vor, «ein ‹Reset› in Form einer partizipativen, zukunftsgerichteten Verkehrsplanung zu starten, die der Bevölkerung und dem Stadtbild gerechter wird.»
KÄMPFEN LOHNT SICH!
Marc Meichtry, Gemeindepräsident von Brügg, wurde vor vier Jahren nicht zuletzt dank seines langjährigen Engagements gegen das erste Ostastprojekt gewählt. Zur Erinnerung: Die ursprünglich im Brüggmoos geplanten Autobahnanschlussbauten waren noch wesentlich grösser dimensioniert und hätten die betroffenen Gemeinden noch viel stärker beeinträchtigt, als dies mit dem heutigen, auch nicht gerade diskreten, Bauwerk der Fall ist.
«Wir haben Unterschriften gesammelt. Als wir Einsprache eingelegt haben, war die Ausgangslage die gleiche wie jetzt beim Westast. Das Ausführungsprojekt lag bereits auf, als wir sagten: so nicht. Und dann wurde es neu geplant», berichtet Meichtry im heutigen Bieler Tagblatt und ermutigt die WestastgegnerInnen: «Es ist nie zu spät. Was da in Biel geplant ist, ist genauso überdimensioniert, wie das Projekt damals in Brügg.»
Das vollständige Interview im Bieler Tagblatt:
ASTRA ÜBERHOLT SATIRE!
Ob’s an der Hitze liegt? – In der NZZ am Sonntag vom 29. Juli, und als saure Gurke sofort von allen Medien dankbar aufgenommen: «Bund prüft doppelstöckige Autobahnen».
Der Grund: Laut Astra-Direktor Jürg Röthlisberger leiden AutofahrerInnen in der Schweiz unter zu viel Stau, ihre Geduld werde über Gebühren strapaziert. Laut Statistik gab es 2017 auf Schweizer Autobahnen insgesamt 26’000 Staustunden. Bricht man diese grosse Zahl jedoch auf die 6,1 in der Schweiz immatrikulierten Motorfahrzeuge hinunter, ergibt sich pro Fahrzeug gerade noch eine Stauzeit von 15,34 Sekunden – pro Jahr!
Doch Röthlisberger sorgt sich um seine Kundschaft und führt ins Feld, auch AutofahrerInnen hätten – gleich wie BahnfahrerInnen – ein «Anrecht auf verlässliche Verbindungen».
Deshalb sollen in nicht allzu ferner Zukunft weitere Strassenkapazitäten geschaffen werden. Etwa mit dem Bau einer vierten(!) Röhre am Baregg – womit das Astra die wildesten Vorstellungen der Satiriker rechts überholt!
Allerdings weiss Röthlisberger sogar diese Gedankenspiele noch zu toppen: Mit der Aussicht auf einen neuen Tunnel mitten durchs Mittelland – und eben der eingangs erwähnten doppelstöckigen Verkehrsführung durchs Limmattal…
NACHTRAG:
Der Autobahn-Ausbauwahn des Astra-Direktors sorgt auch am Folgetag der Interview-Publikation für Schlagzeilen. Tamedia-Bundeshausredaktor Markus Brotschi kontert in seinem lesenswerten Kommentar mit den Worten: «Wer breitere Strassen baut, erntet noch mehr Verkehr» und weist darauf hin, dass die Antwort auf den Mobilitätsdrang nicht nur Beton sein könne…
Der Kommentar im TA vom 30.7.2018:
INTERVIEW MIT KURT ROHNER:
GROSSE RESONANZ

«Meine Idee löst im Seeland drei Probleme», wurde der Bieler Architekt und Raumplaner Kurt Rohner im Samstagsinterview vom 7. Juli im Bieler Tagblatt zitiert.
Seit über einem Jahr wird der Doyen der Raumplanung im Seeland nicht müde, einen runden Tisch zu fordern, um die Verkehrszukunft der Region neu zu diskutieren. Seit Jahren denkt und plant Kurt Rohner zudem an Alternativen zum stadtzerstörerischen Westast… Gut, dass seine Stimme nun endlich auch vom Bieler Tagblatt gehört und weiter verbreitet wurde!
Viele haben das Interview gelesen – letzte Woche war es in Biel immer wieder Gesprächsthema. Davon zeugt auch der heutige Leserbrief von Hans Erb, der auf interessante Aspekte hinweist.
So schreibt er unter anderem: «Es sieht also so aus, als ob vor allem die sich gerne selbst der Weitsicht rühmende Stöckli-Begleitkommission ihren Job lausig gemacht hat, und nicht die Planer. Die dürften nüämlich einfach geplant haben, was man ihnen auf Basis von 60er Jahre-Ideen vorgegeben hat.»
Und weiter: «Auch Rohners Alternativen zur Verkehrsfürung Seevorstadt – Brüggmoss sowie seine ‹kleine Seelandtangente› verdienen es, nochmals geprüft zu werden. ‹Das dauert vil zu lange und ist viel zu teuer› wird dann gerne als Argument vorgebracht. Echt jetzt? Meiner Meinung nach ist kein Preis zu hoch und keine Dauer zu lang, um Rohners im Interview geäussertes Motto ‹Gutes erhalten, Verbesserbares verbessern, Irreversibles möglichst verhindern› zu berücksichtigen.»
Der Leserbrief vom 16.7.2018:
Seeland- Verkehrskorrektion Jetzt!
Massnahme Nr. 1
Ab 1.8.2025:
Fahrverbot für Transit-Schwerverkehr über 7.5 Tonnen auf der A5 zwischen Thielle und Stadtgrenze Biel.
Massnahme Nr. 2
Fertigstellung Autobahnverbindung A5-A1 zwischen Thielle und Kerzers bis Ende 2028
Massnahme Nr. 3
Rückklassierung und Rückbau A5 zwischen Thielle und Biel. Auf dem modernisierten Trassee: Einrichtung der gesamtschweizerisch ersten Teststrecke für selbstfahrende Elektrofahrzeuge bis 2024
745 BÄUME WOLLEN DIE FÄLLEN…


LINK zu den Baumaktionen vom Juni 2016
VEREIN «NETZWERK BIELERSEE» GEGEN A5-WESTAST
Zur Auffrischung: es gibt 100 gute Gründe gegen das Autobahnprojekt aus dem letzten Jahrhundert. Hier die Argumente des Vereins «Netzwerk Bielersee».